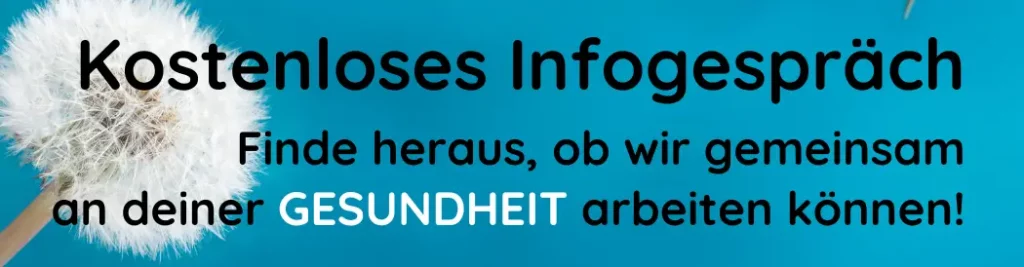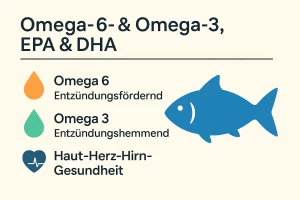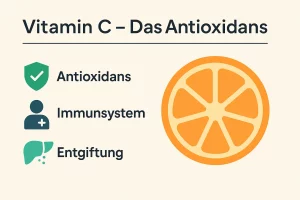Der dauerhafte Konsum artfremder Milch und Milchprodukte – insbesondere, wenn sie im Sinne ihres ursprünglichen Zwecks als „Babynahrung“ betrachtet werden – wirft aus ernährungsphysiologischer und hormoneller Sicht Fragen auf. Dieser Artikel beleuchtet mögliche Gesundheitsrisiken und Zusammenhänge.
📄 Leseempfehlung Studien: Wo Wahrheit stört und Schweigen sich lohnt
- Mögliche Gesundheitsrisiken durch den Konsum von Milch
- A1- / A2-Milch: Unterschiede & Auswirkungen
- Hornträger vs. Hornlose
- Enthornung & genetisch hornlose Zuchtlinien
- Weidehaltung vs. Kraftfutter
- Trächtigkeit & Milchproduktion: Natürlicher Zyklus vs. Milchwirtschaft
- Milch & Milchprodukte: Ein Milliardengeschäft !!!
- Profiteure der Milchwirtschaft
- Strategien zur Unterdrückung / Entkräftung kritischer Informationen über Milch
- Milch & Kalzium
- MTOR-Signalsystem: Wie Milch das Zellwachstum beeinflusst
- DOKU-Tipps / FAZIT / Ärztlicher Hinweis
GRATIS Download des ganzen Artikels (PDF 8 Seiten)
Mögliche Gesundheitsrisiken durch den Konsum von Milch
Menschlicher Stoffwechsel & Unverträglichkeiten: Tiermilch ist auf die Bedürfnisse Ihrer Nachkommen abgestimmt und unterscheidet sich in ihrer Nährstoffzusammensetzung von dem, was für Menschen optimal wäre. Ihre Proteine, Mineralstoffe und das Fett-Kohlenhydrat-Verhältnis können die Verdauung belasten – selbst ohne Laktoseintoleranz.
Entzündungen & Hautprobleme: Bestimmte Milchbestandteile können entzündliche Prozesse im Körper fördern und das Risiko für chronische Erkrankungen erhöhen. Untersuchungen zeigen, dass Milchprodukte das Hautbild verschlechtern und Akne begünstigen können.
Hormonelle Einflüsse & Wachstumsfaktoren: Milch enthält IGF-1, ein Wachstumshormon, das die Zellteilung fördert und mit einem erhöhten Risiko für hormonabhängige Krebserkrankungen assoziiert wird. Zusätzlich enthaltene Sexualhormone wie Östrogen und Progesteron können das endokrine System beeinflussen und hormonelle Ungleichgewichte begünstigen.
Proteine, Immunreaktionen & Allergien: Kuhmilch enthält vorwiegend A1-Beta-Casein, dessen Abbauprodukte mit Verdauungsproblemen und Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht werden. Fremdproteine können das Immunsystem belasten, allergische Reaktionen auslösen und chronische Entzündungen fördern.
Stoffwechsel, Insulinreaktion & Fettzusammensetzung: Bestimmte Milchbestandteile beeinflussen den Insulinspiegel und könnten langfristig das Risiko für Stoffwechselstörungen wie Typ-2-Diabetes erhöhen. Zudem enthält Kuhmilch gesättigte Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel steigern und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen können.
A1- / A2-Milch: A1- und A2-Milch unterscheidet sich in der Struktur des Beta-Kasein-Proteins, einem Bestandteil des Milcheiweißes. Ursprünglich produzierten alle Kühe das A2-Gen. Vor etwa 5.000 bis 8.000 Jahren trat in einigen europäischen Rinderrassen eine spontane Mutation auf, die das A1-Gen hervorbrachte. Diese Veränderung führte dazu, dass das Beta-Kasein-Protein in manchen Kühen nun die A1-Variante anstelle von A2 enthielt. Die Verbreitung der A1-Variante wurde durch Zucht begünstigt, da leistungsstarke Milchviehrassen wie Holstein- / Friesenkühe überwiegend A1-Milch produzieren.
A1-Milch*1
- Herkunft: Überwiegend von Holstein- / Friesenkühen (häufigsten Milchkühe in Europa / Nordamerika).
- Proteinstruktur: An Position 67 im Beta-Kasein-Protein ist die Aminosäure Histidin anstelle von Prolin eingebaut.
- Verdauung: Dieser Unterschied führt dazu, dass beim Verdauungsprozess das bioaktive Peptid BCM-7 freigesetzt werden kann.
- Mögliche Beschwerden im Zusammenhang mit BCM-7
- Entzündliche Reaktionen
- Verdauungsbeschwerden (z.B. Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall – auch ohne Laktoseintoleranz)
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Diabetes Typ 1
- Auslösen von Atherosklerose
- Störungen im Fettstoffwechsel
- Neurologische Erkrankungen (z.B. Autismus, Schizophrenie)
- Histidin / Histamin: Zudem kann das in A1-Milch enthaltene Histidin im Körper potenziell zu Histamin umgewandelt werden, was bei Menschen mit Histaminintoleranz / gestörter Histaminverwertung zu Symptomen wie Hautreaktionen, Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden führen kann.
A2-Milch
- Herkunft: Überwiegend von Jersey-, Guernsey-, asiatischen und afrikanischen Rinderrassen sowie von Ziegen und Schafen.
- Proteinstruktur: An Position 67 im Beta-Kasein-Protein ist die Aminosäure Prolin anstelle von Histidin eingebaut.
- Verdauung: Diese Struktur verhindert die Freisetzung von BCM-7 während der Verdauung.
- Histidin / Histamin: Da an dieser Stelle kein Histidin vorhanden ist, wird auch keine potenzielle Umwandlung zu Histamin ausgelöst.
- A2-Milch gilt deshalb als verträglicher, besonders für Menschen mit empfindlicher Verdauung / Milchunverträglichkeit, die nicht auf Laktose zurückzuführen ist.
- Verfügbarkeit: A2-Milch wird zunehmend als Alternative angeboten und ist in vielen Ländern speziell gekennzeichnet oder von bestimmten Marken erhältlich.
Hornträger vs. Hornlose: Kühe mit Hörnern haben tendenziell andere Hormonspiegel als hornlose (enthornte oder genetisch hornlose) Kühe, insbesondere im Bereich von Stress- / Stoffwechselhormonen.
- Cortisol (Stresshormon)
- Kühe, die enthornt werden, erleben kurzfristig einen Anstieg des Stresshormons Cortisol.
- Kühe mit natürlichen Hörnern haben in stabilen Haltungsbedingungen oft niedrigere Cortisolwerte.
- Oxytocin (Bindungs- / Entspannungshormon)
- Hörnertragende Kühe haben oft sozial stabilere Herdenstrukturen.
- Oxytocin, das bei positiven sozialen Interaktionen/ Melken ausgeschüttet wird, könnte in Herden mit hörnertragenden Kühen tendenziell höher sein.
- Wachstumshormone (IGF-1, Somatotropin)
- Das Wachstum der Hörner hängt mit bestimmten Wachstumshormonen wie IGF-1 zusammen.
- Kühe mit Hörnern können andere IGF-1-Spiegel haben als genetisch hornlose Kühe.
- Sexualhormone (Östrogen, Testosteron, Progesteron)
- Der Stoffwechsel von Sexualhormonen könnte durch das Vorhandensein von Hörnern beeinflusst werden.
- Testosteron, das auch in Kühen vorkommt, könnte in Kühen mit Hörnern leicht erhöht sein.
Enthornung & genetisch hornlose Zuchtlinien: Die Enthornung oder genetisch hornlose Zuchtlinien (wie bei Bioland erlaubt) kann potenziell verschiedene Auswirkungen auf die Inhaltsstoffe der Kuhmilch haben. Beispiele:
- Stresslevel & Hormonhaushalt:
- Die Enthornung ist ein schmerzhafter Eingriff, der Stress verursacht. Stress kann die Cortisolwerte erhöhen, was Auswirkungen auf den Fett- /Proteingehalt der Milch haben kann.
- Bei genetisch hornlosen Kühen (z.B. mit dem Polled-Gen) entfällt dieser Stressfaktor.
- Fütterung & Stoffwechsel:
- Hornlose Zuchtlinien können einen leicht veränderten Stoffwechsel haben. Beispielsweise wurden in Unterschiede in der Futterverwertung oder im Körperbau festgestellt.
- Diese metabolischen Unterschiede können sich auf die Zusammensetzung der Milch auswirken, insbesondere auf den Fett- / Proteingehalt.
- Genetische Unterschiede & Milchleistung:
- Hornlose Zuchtlinien stammen oft aus selektiver Zucht, die sich nicht nur auf Hornlosigkeit, sondern auch auf andere genetische Merkmale auswirkt.
- Genetisch hornlose Kühe können eine geringfügig geringere Milchleistung haben oder Unterschiede in der Milchfettsäurenzusammensetzung aufweisen.
- Langfristige Auswirkungen & Milchqualität:
- Bisher gibt es keine eindeutigen Hinweise darauf, dass die Milch von genetisch hornlosen Kühen grundsätzlich eine schlechtere Qualität hat.
- Zuchtstrategien können jedoch die Zusammensetzung beeinflussen.
Weidehaltung vs. Kraftfutter: Die Fütterung hat einen erheblichen Einfluss auf die Inhaltsstoffe der Kuhmilch, insbesondere auf den Fettgehalt, die Fettsäurezusammensetzung, den Vitamingehalt und sekundäre Pflanzenstoffe. Der größte Unterschied zeigt sich zwischen Gras- / Weidefütterung und einer Fütterung mit Kraftfutter (z.B. Getreide, Soja, Silage).
- Fettgehalt & Fettsäurezusammensetzung
- Weidemilch enthält mehr Omega-3-Fettsäuren (z.B. Alpha-Linolensäure, ALA).
- Kraftfutter erhöht den Gehalt an Omega-6-Fettsäuren (z.B. Linolsäure), was das Omega-3/6-Verhältnis verschlechtert.
- Hinweis: Omega-3 wirkt entzündungshemmend / Omega-6 wirkt entzündungsfördernd.
- Weidemilch enthält bis zu doppelt so viel CLA (konjugierte Linolsäure), eine Fettsäure mit möglichen positiven Effekten auf den Fettstoffwechsel und das Immunsystem.
- Kraftfutter senkt den CLA-Gehalt in der Milch.
- Weidemilch hat meist etwas weniger Fett, aber eine bessere Fettzusammensetzung.
- Kraftfutter kann den Fettgehalt der Milch leicht erhöhen, aber das Fettsäureprofil ist weniger gesund.
- Protein- & Aminosäuregehalt
- Weidemilch enthält oft mehr bioaktive Proteine, die für das Immunsystem förderlich sind.
- Kraftfutter kann den Proteingehalt der Milch leicht erhöhen, z.B. mit proteinreichen Komponenten wie Soja.
- Vitamingehalt (A, D, E, K und Beta-Carotin)
- Weidemilch enthält (durch das frische Gras):
- Mehr Vitamin A → wichtig für Augen, Haut und Immunsystem.
- Mehr Vitamin E → wirkt antioxidativ und schützt Zellmembranen.
- Mehr Beta-Carotin → erkennbar an einer leicht gelblichen Färbung der Butter aus Weidemilch.
- Kraftfutter kann den Vitamin-D-Gehalt leicht erhöhen, vor allem wenn es angereicherte Komponenten enthält.
- Weidemilch enthält (durch das frische Gras):
- Sekundäre Pflanzenstoffe & Antioxidantien
- Weidemilch enthält mehr sekundäre Pflanzenstoffe, die antioxidative Eigenschaften haben. Dazu gehören:
- Polyphenole aus Kräutern und Gräsern.
- Flavonoide, die entzündungshemmend wirken können.
- Terpene, die das Aroma der Milch beeinflussen.
- Kraftfutter enthält weniger dieser wertvollen Stoffe.
- Weidemilch enthält mehr sekundäre Pflanzenstoffe, die antioxidative Eigenschaften haben. Dazu gehören:
- Milchqualität & Geschmack
- Weidemilch hat oft einen volleren, natürlicheren Geschmack, da Kräuter und Gras das Aroma beeinflussen.
- Kraftfutter kann zu einer etwas neutraleren Milch führen, die je nach Futterzusammensetzung auch süßlicher schmecken kann.
Gras-/Weidefütterung verbessert die Milchqualität, da sie:
- Mehr Omega-3-Fettsäuren enthält.
- Mehr antioxidative Pflanzenstoffe enthält.
- Mehr konjugierte Linolsäure (CLA) enthält.
- Höhere Werte an Vitamin A, E und Beta-Carotin enthält.
Trächtigkeit & Milchproduktion – Natürlicher Zyklus vs. Milchwirtschaft: Kühe, ob wild oder domestiziert, sind Säugetiere mit einem natürlichen Fortpflanzungszyklus. Der Unterschied zwischen wilden Kühen und Milchkühen in der industriellen Landwirtschaft liegt hauptsächlich in der Häufigkeit der Trächtigkeit und dem Eingriff des Menschen.
- Trächtigkeit – Natürlicher Zyklus
- Wilde Kühe wie Auerochsen oder verwilderte Hausrinder haben einen natürlichen Fortpflanzungsrhythmus, der stark von Umweltbedingungen abhängt.
- Sie werden einmal pro Jahr oder seltener trächtig (eher alle 1,5 bis 2 Jahre), abhängig von: Futterverfügbarkeit / Rangordnung in der Herde / Klimatischen Bedingungen /Gesundheitszustand der Kuh
- Der Zyklus:
- Brunft (Paarungszeit): Meist im Frühling oder Sommer.
- Trächtigkeit: Ca. 9 Monate.
- Kalbung: Meist im Frühling, wenn Futter reichlich vorhanden ist.
- Laktation (Milchproduktion für das Kalb): Etwa 6–10 Monate, bis das Kalb entwöhnt wird.
- Pause bis zur nächsten Trächtigkeit, um sich zu regenerieren.
- Trächtigkeit – Milchwirtschaft
- In der modernen Milchproduktion werden Kühe ständig in einem Zyklus von Trächtigkeit und Laktation gehalten, um eine maximale Milchleistung zu gewährleisten.
- 1. KB (künstlichen Besamung) im Alter von 15–18 Monaten.
- Danach jährlich, ~60–100 Tage nach einer Kalbung.
- Der Zyklus ist künstlich verkürzt, sodass Kühe jedes Jahr ein Kalb bekommen.
- Die Milchproduktion beginnt nach der Geburt und dauert ~10 Monate (305 Tage).
- Danach folgt eine Trockenstehzeit ~6–8 Wochen, in der die Kuh nicht gemolken wird, um sich auf die nächste Geburt vorzubereiten.
- Nach der Geburt beginnt der Zyklus erneut.
- Folgen für die Kuh
- Starker physiologischer Stress, da der Körper dauerhaft Milch produzieren muss.
- Hohe Stoffwechselbelastung, was zu Krankheiten wie Euterentzündungen (Mastitis) oder Fruchtbarkeitsstörungen führen kann.
- Milchkühe werden nach ~3–5 Jahren geschlachtet, weil ihre Milchleistung nachlässt – obwohl sie eigentlich 15–20 Jahre alt werden könnten.
- Unterschiede in der Bio-Milchwirtschaft
- Auch in der Bio-Landwirtschaft werden Kühe regelmäßig besamt, aber es gibt einige Unterschiede:
- Längere Trockenstehzeit (mind. 8 Wochen), um der Kuh Erholung zu ermöglichen.
- Mehr Weidegang → gesündere Tiere, weniger Stress.
- Weniger Hochleistungszucht → geringere Milchmengen, aber höhere Milchqualität.
- Kalb darf oft länger bei der Mutter bleiben, je nach Betrieb und Label (bei Demeter mind. 3 Monate).
- Häufigere Natursprung-Besamung (Deckbulle), statt nur künstlicher Besamung.
- Bio-Kühe haben i.d.R. eine etwas längere Lebenszeit (~5–7 Jahre) als konventionelle Kühe (~3–5 Jahre), weil sie weniger belastet werden.
Milch & Milchprodukte: Ein Milliardengeschäft: Die Umsatzzahlen der Milchindustrie zeigen klar, worum es wirklich geht – und nein, nicht um unsere Gesundheit, sondern um knallharte Profite, trotz aller Werbeversprechen.
- Deutschland:
- Milcherzeugung in der Landwirtschaft: Der Umsatz im deutschen Milchsektor liegt je nach Quelle / Jahr im Bereich von etwa 10 bis 11 Milliarden Euro.
- Milchverarbeitung in der Industrie: Die Weiterverarbeitung von Milch zu Produkten wie Käse, Joghurt, Butter und anderen Erzeugnissen generiert einen deutlich höheren Umsatz von über 20 Milliarden Euro.
- Weltweit: Der globale Markt für Milch und Milchprodukte wird auf rund 600 bis 700 Milliarden US-Dollar geschätzt. Prognosen schätzen eine jährliche Wachstumsrate von etwa 4–5 %.
Profiteure der Milchwirtschaft: Mehrere mächtige Interessensgruppen, haben wenig Interesse daran, dass gesundheitliche Bedenken bezüglich Milch und Milchprodukten eine breite Öffentlichkeit erreichen. Dazu gehören insbesondere:
- Milchindustrie und Molkereikonzerne
- Große Molkereien und Lebensmittelkonzerne generieren Milliardenumsätze mit Milchprodukten.
- Negative Berichterstattung könnte die Nachfrage senken und die Gewinne schmälern.
- Einfluss auf Forschung und Wissenschaft: Studien, die Milch positiv darstellen, werden oft von der Industrie finanziert. Kritische Forschung wird seltener gefördert oder bleibt unveröffentlicht.
- Landwirtschaftsverbände und Lobbyorganisationen
- Organisationen wie der Deutsche Bauernverband oder der Milchindustrie-Verband vertreten die Interessen der Landwirte und Milchproduzenten.
- Sie setzen sich für staatliche Subventionen, Werbekampagnen und politische Unterstützung ein.
- Einfluss auf Gesetzgebung und politische Entscheidungen, z.B. durch Lobbyarbeit in der EU oder nationalen Regierungen.
- Supermärkte, Discounter, Lebensmittelindustrie
- Milchprodukte gehören zu den umsatzstärksten Kategorien.
- Alle Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette – von der Produktion bis zum Handel – haben ein großes wirtschaftliches Interesse daran, Milchprodukte als gesund zu vermarkten und die Nachfrage hochzuhalten.
- Werbung und Marketingstrategien beeinflussen Verbraucher durch gezielte Gesundheitsversprechen.
- Pharmaindustrie (indirekt)
- Eine hohe Krankheitsrate durch problematische Ernährungsgewohnheiten kann auch für die Pharmaindustrie von Vorteil sein.
- Steigende Zahlen von Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder chronisch-entzündlichen Erkrankungen könnten langfristig den Absatz von Medikamenten erhöhen.
Strategien zur Unterdrückung / Entkräftung kritischer Informationen über Milch
- Beeinflussung der Wissenschaft
- Finanzierung gezielter Studien, die Milchprodukte als gesund darstellen, während kritische Forschung oft wenig Unterstützung erhält.
- Studien mit negativen Ergebnissen werden zurückgehalten oder deren Aussagen abgeschwächt.
- Kritische Wissenschaftler können unter Druck gesetzt oder in ihrer Glaubwürdigkeit angegriffen werden.
- Marketing & Werbung
- Slogans wie „Milch macht stark“ oder „Gut für die Knochen“ prägen seit Jahrzehnten das öffentliche Bewusstsein.
- Prominente / Experten werden gezielt eingesetzt, um Milch als gesund zu vermarkten.
- Werbung richtet sich besonders an Kinder und Eltern, um den Konsum früh zu etablieren.
- Einfluss auf Medien & Berichterstattung
- Molkereikonzerne und Lobbygruppen beeinflussen Medienunternehmen.
- Kritische Berichte werden verdrängt oder durch positive Berichterstattung relativiert.
- In Talkshows / Nachrichten treten meist Vertreter der Milchindustrie auf, während kritische Stimmen seltener gehört werden.
- Politische Einflussnahme & Subventionen
- Staatliche Subventionen halten Milchprodukte günstig und fördern den Konsum.
- Schulmilchprogramme gewöhnen Kinder früh an den Verzehr.
- Landwirtschaftsministerien stehen oft in enger Verbindung mit der Milchindustrie und unterstützen aktiv deren Interessen.
- Diskreditierung von Kritikern
- Ärzte, Ernährungswissenschaftler oder Aktivisten, die auf Risiken hinweisen, werden als „extrem“, „unwissenschaftlich“ oder „militant“ dargestellt.
- Kritische Inhalte auf Social Media werden durch Gegenkampagnen relativiert oder als Einzelfälle abgetan.
Milch & Kalzium: Calcium (Ca) ist ein essenzieller Mineralstoff, mit einer zentralen Rolle bei – Bildung / Erhaltung von Knochen und Zähnen, Steuerung von Muskelkontraktionen, Blutgerinnung und zahlreicher weiterer Zellfunktionen. Etwa 99 % des Kalziums sind in Knochen und Zähnen gespeichert. Der Körper reguliert den Kalziumspiegel, indem er Kalzium bei Bedarf aus den Knochen freisetzt oder einlagert.
Kalzium-Paradoxie: Je mehr Kuhmilch in einer Population konsumiert wird, desto höher ist paradoxerweise die Osteoporose. Mögliche Ursachen:
- Längere Lebenserwartung & bessere Erkennung
- Länder mit hohem Milchkonsum haben auch eine höhere Lebenserwartung.
- Länder mit hohem Milchkonsum haben ein besseres Gesundheitssystem, sodass mehr Osteoporose-Fälle erkannt werden können.
- Kalzium-Phosphor-Ungleichgewicht (Phosphat-Toxizität)
- Kuhmilch enthält nicht nur Kalzium, sondern sehr viel Phosphor. Ein zu enger Kalzium-Phosphor-Quotient kann über eine sekundäre Hyperparathyreoidismus-Reaktion zur Kalziummobilisierung aus dem Knochen führen.
- Untersuchungen zeigen, dass hohe Phosphorzufuhr (z. B. durch Milch, Softdrinks, verarbeitete Lebensmittel) die Knochen entkalzifizieren und so Osteoporose begünstigen kann.
- Protein-„Acid-Ash“-Hypothese
- Hoher Konsum tierischer Proteine (Milcheiweiß, Fleisch) produziert metabolische Säure, die im Urin Calcium ausschwemmt (acid-ash hypothesis).
- Vitamin D / Sonnenlicht
- In nördlichen Breiten ist die endogene Vitamin D-Bildung – vor allem im Winter stark eingeschränkt. Ohne ausreichend Vitamin D kann Kalzium aus der Nahrung kaum in den Knochen eingebaut werden.
- Lebensstil- / genetische Faktoren
- Bewegungsmangel, Rauchen, Alkoholkonsum, bestimmte Medikamente, chronische Erkrankungen und genetische Veranlagung spielen ebenso eine große Rolle für die Knochenfestigkeit.
- Länder mit hohem Milchkonsum sind häufig industrialisiert: Sitztätigkeit und wenig knochenbelastende Aktivität erhöhen das Risiko weiter.
Absorption
- Bioverfügbarkeit: Milch-Calcium etwa 30 %; Gemüse / Nüsse teils weniger (Oxalate, Phytate hemmen).
- Vitamin D erhöht die Aufnahme.
Mangel & Überschuss
| Zustand | Ursachen | Folgen |
|---|---|---|
| Hypocalcämie | Vitamin-D-Mangel, PTH-Störung, Malabsorption | Muskelschwäche, Krämpfe, Herzrhythmusstörungen |
| Hypercalcämie | Hyperparathyreoidismus, Tumoren, Überdosierung von Supplements | Müdigkeit, Nierensteine, Herzprobleme |
MTOR-Signalsystem: Wie Milch das Zellwachstum beeinflusst: MTOR *2 (mechanistic target of rapamycin) ist ein Proteinkomplex, und spielt eine zentrale Rolle im Zellwachstum, Stoffwechsel und Überleben, sowie eine wichtige Rolle bei Krankheiten wie Krebs, Diabetes und neurodegenerativen Erkrankungen. Medikamente, die mTOR hemmen (z.B. Rapamycin), werden in der Krebsbehandlung, Immunsuppression und Anti-Aging-Forschung eingesetzt. Es gibt zwei Hauptkomplexe:
- mTORC1 (mTOR-Komplex 1) – Reguliert Proteinsynthese, Stoffwechsel und Autophagie (Abbau beschädigter Zellbestandteile). Er wird durch Nährstoffe und Wachstumsfaktoren aktiviert und ist empfindlich gegenüber Rapamycin.
- mTORC2 (mTOR-Komplex 2) – Beeinflusst Zellstruktur, Überleben und Stoffwechsel. Er ist weniger empfindlich gegenüber Rapamycin.
Milch aktiviert MTOR, hauptsächlich durch zwei Mechanismen:
- Hoher Gehalt an Leucin (einer verzweigtkettigen Aminosäure, BCAA)
- Leucin ist der stärkste natürliche Aktivator von mTOR, da es direkt Signalwege stimuliert, die Zellwachstum / Proteinsynthese fördern.
- Milch enthält relativ viel Leucin, insbesondere in Molkenprotein (Whey).
- Insulin und IGF-1: Milch fördert die Ausschüttung von Insulin und IGF-1, die beide mTOR aktivieren und das Zellwachstum sowie die Muskelproteinsynthese stimulieren.
GRATIS Download des ganzen Artikels (PDF 8 Seiten)
DOKU-Tipps: 🎦 Video / 📄 Info – Die Reihenfolge ist keine Wertung.
🎦 ZDF zoom – Der Irrsinn mit der Milch
🎦 Dinge Erklärt – Die Wahrheit über Milch – So ungesund ist sie wirklich
🎦 SRF Wissen – Milch: Natürlicher Muntermacher oder schädlich für die Gesundheit?
🎦 Breaking Lab – Milchmythen: Pflanzendrinks sind kein Milchersatz – Sagt eine Studie des Schweizer Forschungszentrum Agroscope
🎦 SWR – Ausschnitt aus „Das System Milch“
🎦 Wer streamt es? – Das System Milch: Kosten & Folgen für Umwelt & Gesundheit von Milch & Milcherzeugnissen
🎦 Galileo – Krebserregend?! Wie gesund ist Milch wirklich? Milch erhöht Wachstumsfaktor IGF-1 und stimuliert Wachstum von Knochen und Körpergewebe! Und Krebszellen?
🎦 Quarks – Woraus besteht Milch? / Brauchen wir Milch? Umstellung von A1 auf A2 Milch – Auswirkungen?
Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland etwa: 50 kg Trinkmilch + 24 kg Käse + 16 kg Joghurt + 13 kg Sauermilch + 5 kg Butter + 5 kg Sahne
🎦 NDR 45 Minuten – Die Milchlüge: Großangelegte Marketingkonzepte von Industrie / Medizin sorgen für einen guten Absatz der Milchprodukte, da diese immer wieder in Verbindung mit gesunder Nahrung gebracht werden. In Wirklichkeit bedeutet der Konsum von Milchprodukten eine kaum zu überwindende Belastung des Organismus, die sich nach Jahren als schwerwiegende Erkrankung manifestieren kann. Allergien, Entzündungen, Diabetes, Rheuma, Herzinfarkt und Krebs können die Folgen von dauerhaftem Milchkonsum sein.
📄 *1 Max Rubner-Institut – Wissenschaftliche Bewertung der A1-A2-Milch
🎦 *2 Prof. Dr. Bodo Melnik – Ist Milch gesund? Medizinische Fakten!
🎦 Dr. med. Ruediger Dahlke – Milch enthält viel Kalzium. Stimmt das?
🎦 Dr. med. Petra Wiechel – Milch macht müde Männer munter oder gesunde Männer krank?
Kritisch bleiben: Auch wenn ein Arzt oder Wissenschaftler etwas empfiehlt oder verkauft, beweist das nicht seine Wirksamkeit. Gründliche Recherche / Rücksprache kann helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden.
FAZIT: Die wissenschaftliche Debatte zum Themen Milch und Milchprodukte ist komplex und nicht alle Untersuchungen sind sich einig. Wie auch!? Milch und Milchprodukte sind ein milliardenschweres Geschäft. Direkt & indirekt!
Die Kombination aus wirtschaftlichen Interessen, gezieltem Marketing / Medienarbeit und politischer Einflussnahme sorgt dafür, dass kritische Informationen über Milch nur langsam in die öffentliche Wahrnehmung gelangen. Trotz wachsender wissenschaftlicher Hinweise auf gesundheitliche Risiken wird Milch weiterhin als „unverzichtbares Grundnahrungsmittel“ dargestellt – ein Narrativ, das vor allem von den Profiteuren aufrechterhalten wird.
Es lohnt sich also – sowohl für die eigene Gesundheit als auch im Hinblick auf das Tierwohl – den Konsum von Milch und Milchprodukten kritisch zu hinterfragen und, insbesondere bei bestehenden gesundheitlichen Problemen, Alternativen in Betracht zu ziehen.
Hinweis: Dieser Artikel wurde von einem Ernährungsberater verfasst und dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Er ersetzt keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellt keine Therapie dar.
Medizinischer Disclaimer
Ärztlicher Hinweis: Vor eigenmächtigen Anwendungen oder Einnahmen sollte ein Arzt konsultiert werden, um Risiken sowie Neben- oder Wechselwirkungen – z. B. mit Medikamenten – auszuschließen.