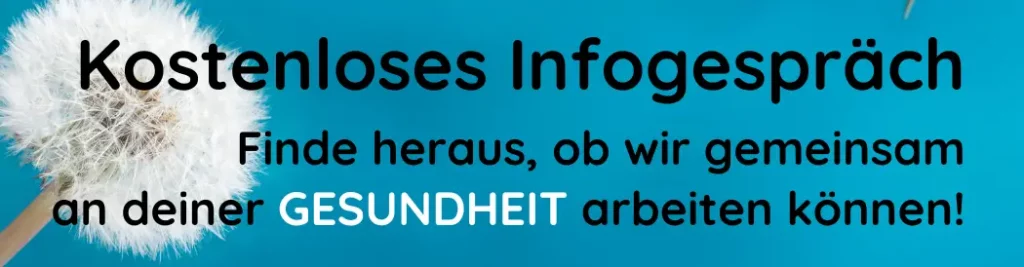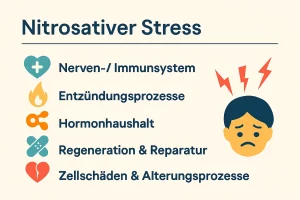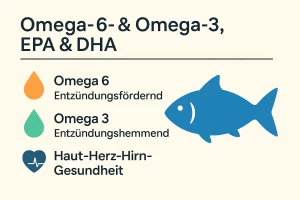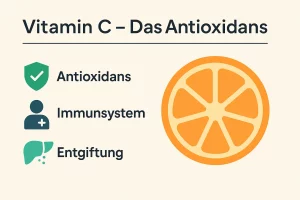Ohne Proteine kein Leben, keine Abwehr, keine Reparatur! Sie steuern das Immunsystem, bekämpfen Krankheitserreger, reparieren Zellen. Erfahre jetzt, warum Proteine die stärkste Gesundheitswaffe sind.
- Grundlagen
- Begriffserklärungen
- Essentielle Aminosäuren – kurz erklärt
- Aminosäuren – Die Bausteine von Proteinen: Übersicht & Funktionen im Körper
- EAA & BCAA: Essentielle und verzweigtkettige Aminosäuren und ihre Bedeutung
- Proteinqualität: Biologische Wertigkeit von Proteinen
- Limitierende Aminosäure: Eine fehlende Aminosäure kann die Verwertung bremsen
- Zufuhr & Bedarf
- Proteinmangel: Mögliche Folgen einer unzureichenden Proteinzufuhr
- Proteinüberschuss: Mögliche Folgen einer zu hohen Proteinzufuhr
- Zufuhrempfehlung – Protein: Richtwerte für die tägliche Proteinzufuhr
- Zufuhrempfehlung – Aminosäuren: Richtwerte für einzelne Aminosäuren (WHO)
- Aminosäurengehalt in Lebensmitteln: Variiert aufgrund mehrerer Faktoren
- Verdauung & Stoffwechsel
- Resorption: Aufnahme & Verwertung von Proteinen / Aminosäuren im Körper
- Proteinreise durch den Körper: Von der Nahrung bis in die Zelle
- Aminosäureabbau: Einfluss auf Säure-Basen-Haushalt
- Konkurrenz zwischen Aminosäuren: Gemeinsame Transportwege im Darm
- Magensäuremangel: Einfluss auf die Proteinverdauung
- Funktionen & Wirkungen
- Hormone brauchen Proteine – täglich: Einfluss auf den Hormonhaushalt
- Tabelle zentraler Hormone: Name, Bildungsort, Funktion, Thema bei
- Männliche Potenz braucht Proteine: Einfluss auf die sexuelle Gesundheit
- Anabol & Katabol: Auf- und abbauende Prozesse im Körper
- Proteinspeicher: Begrenzter Aminosäuren-Pool in Blut und Gewebe
- Spezielle Proteine & Aminosäuren
- Kollagen: Eigenschaften / Funktionen dieses wichtigen Strukturproteins
- Vegane Kollagen-Quellen: Pflanzliche Alternativen
- Weizenprotein: Gesundheitliche Risiken, mögliche Reaktionen
- Sojaprotein: Gesundheitliche Risiken, mögliche Reaktionen
- Birken-Soja-Kreuzallergie: Birkenpollenallergiker reagieren oft kreuzallergisch
- Isolierte Aminosäuren: Zielgerichtet supplementieren statt Proteine zählen
- Moderne Belastungen & Diagnostik
- Moderner Lebensstil: Belastungen & Einfluss auf Nährstoff- / Aminosäurebedarf
- Silent Inflammation: Ernährung, Diagnostik und systemische Folgen
- Aminosäurestatus: Referenzwerte vs. tatsächlicher Bedarf
- Entzündungen: Standard- / Zusatzmarker
- Doku-Tipps / Fazit / Ärztlicher Hinweis
GRATIS Download des ganzen Artikels (PDF 22 Seiten)
- Proteine (Eiweiße): Bausteine des Körpers – sie sind bei Aufbau / Funktion von Zellen beteiligt und bilden Enzyme, Hormone, Transportmoleküle und Strukturelemente.
- Aminosäuren (AS): Sind die Einzelteile, aus denen Proteine bestehen – wie Perlen auf einer Kette. Es gibt 20 verschiedene, 9 davon muss man zuführen (essentielle Aminosäuren).
- Peptide: Kurze Ketten aus Aminosäuren (unter 50), also kleine Proteine. Wirken häufig als Botenstoffe / Hormone.
- Kollagen: Häufigstes Protein im Körper (etwa 30 % des gesamten Proteinanteils).
- Anabol = Aufbau (A wie Aufbau): Der Körper baut etwas auf, z.B. Zellen.
- Katabol = Abbau (K wie Kaputtmachen): Der Körper baut etwas ab, z.B. um Energie zu gewinnen.
Essentielle Aminosäuren – kurz erklärt:
- Histidin: Vorstufe von Histamin; wichtig für Immunabwehr / Magensäurebildung
- Isoleucin (BCAA): Erhält Immun- / Organzellen; Energielieferant bei Stress
- Leucin (BCAA): Aktiviert mTOR; fördert Zell- / Gewebereparatur
- Lysin: Wichtig für Kollagen- / Carnitinsynthese; fördert Gewebereparatur / Fettstoffwechsel
- Methionin: Wichtig für Entgiftungs- / Reparaturprozesse in Leber und anderen Organen
- Phenylalanin: Vorstufe von Tyrosin, Dopamin und Noradrenalin
- Threonin: Bestandteil von Immunproteinen; unterstützt Darm- / Leberfunktion
- Tryptophan: Vorstufe von Serotonin / Melatonin; fördert Stimmung / Schlaf
- Valin (BCAA): Reguliert Stickstoffhaushalt; hilft bei Gewebereparatur
Aminosäuren – Die Bausteine von Proteinen: Proteine sind äußerst vielseitige und teils essentielle Bausteine (Moleküle) und spielen eine entscheidende Rolle in nahezu allen biologischen Prozessen.
- Strukturelle Funktionen: Proteine sind Hauptbestandteile vieler Gewebe. Kollagen, ein strukturierendes Protein, verleiht Haut, Knochen, Sehnen und Bändern Festigkeit und Elastizität. Andere Proteine bilden das Gerüst der Muskelfasern und ermöglichen die Kontraktion und Entspannung der Muskeln.
- Transportfunktionen: Einige Proteine dienen als Transportmoleküle, die z.B. Sauerstoff, Nährstoffe und Hormone befördern. Hämoglobin in den roten Blutkörperchen ist z.B. ein Transportprotein, das Sauerstoff von der Lunge zu den Geweben und Kohlendioxid aus den Geweben zurück zur Lunge bringt.
- Enzymatische Funktionen: Enzyme sind Proteine, die als Biokatalysatoren fungieren und chemische Reaktionen im Körper beschleunigen. Unerlässlich für den Stoffwechsel, Verdauung, Energiegewinnung und andere lebenswichtige Prozesse.
- Hormonelle Funktionen: Einige Proteine dienen als Hormone, die als Botenstoffe fungieren und verschiedene physiologische Prozesse wie Stoffwechsel, Wachstum und Fortpflanzung regulieren. Insulin z.B. ist ein Proteinhormon, das den Blutzuckerspiegel reguliert.
- Immunologische Funktionen: Antikörper sind Proteine des Immunsystems, die fremde Substanzen, z.B. Krankheitserreger neutralisieren und zur Aufrechterhaltung der Immunität dienen.
- Regulatorische Funktionen: Proteine können als Regulatoren fungieren, indem sie die Expression von Genen kontrollieren oder Signalwege in Zellen modulieren.
- Struktur- / Bewegungsfunktionen: Proteine bilden das Gerüst von Zellen und ermöglichen deren Formgebung, Bewegung und Teilung. Sie sind auch an intrazellulären Transportprozessen beteiligt.
Essentielle Aminosäuren: Können vom Körper nicht selbst hergestellt werden und müssen regelmäßig (bestenfalls täglich) zugeführt werden.
- Histidin: Relevant für Wachstum und Reparatur von Gewebe, Bildung von roten & weißen Blutkörperchen sowie Regulierung des pH-Werts.
- Isoleucin, Leucin, Valin (= BCAA – verzweigtkettige Aminosäuren): Unterstützen den Muskelaufbau und die Regeneration nach dem Training. Relevant bei der Energieproduktion während intensiver körperlicher Aktivität.
- Lysin: Relevant bei der Bildung von Kollagen (Gesundheit von Haut, Knorpel, Knochen), der Resorption von Kalzium und der Produktion von Hormonen, Enzymen und Antikörpern.
- Methionin: Vorläufer für die Synthese von z.B. Carnitin und Creatin. An der Entgiftung beteiligt, insbesondere von Schwermetallen.
- Phenylalanin: Vorläufer für die Synthese von Neurotransmittern wie Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin. Erforderlich für die Bildung von Tyrosin. Relevant bei der Stimmungsregulation, der Schmerzkontrolle und Hautgesundheit.
- Threonin: An der Bildung von Kollagen, Elastin und Muskelgewebe beteiligt. Unterstützt die Gesundheit von Leber, Herz und Zentralnervensystem. Relevant bei der Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln. Kann das Immunsystems unterstützen.
- Tryptophan: Vorläufer von Serotonin, der Stimmung, Schlaf und Appetit reguliert. Relevant bei der Proteinsynthese und dem Immunsystem. Kann zur Synthese von Niacin (Vitamin B3) verwendet werden.
Nicht-essentielle Aminosäuren: Können vom Körper selbst hergestellt werden, aus anderen Aminosäuren / Vorläufern.
Semi-essentielle Aminosäuren: Können vom Körper ebenfalls selbst hergestellt werden. Unter bestimmten Bedingungen z.B. Krankheit, Stress, ist der Bedarf erhöht und die körpereigene Produktion reicht nicht aus.
- Alanin: Brennstoff für Energieproduktion, besonders während langer Belastungen oder Fastenzeiten. Kann helfen den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, indem es Glukose aus der Leber freisetzt. Stärkung des Immunsystems.
- Arginin: Vorläufer für Stickstoffmonoxid (NO), das Blutgefäße entspannen und Durchblutung verbessern kann. Relevant im Immunsystem und Wundheilung.
- Asparagin: An der Synthese von Neurotransmittern, Nukleotiden und anderen Aminosäuren beteiligt. Relevant bei der Entgiftung.
- Asparaginsäure: Wichtig für den Energiestoffwechsel und Synthese von anderen Aminosäuren.
- Cystein: Wichtiger Bestandteil von Glutathion, einem starken Antioxidans, das oxidative Schäden bekämpft und vor Toxinen schützt.
- Glutamin: Am häufigsten vorkommende Aminosäure. Relevant im Immunsystem, Darmgesundheit und Stickstoffstoffwechsel. Brennstoff für Zellen, die schnell wachsendes Gewebe produzieren, z.B. Darmzellen.
- Glutamat (Glutaminsäure): An der Synthese von GABA (Gamma-Aminobuttersäure), beteiligt, der beruhigende Effekte im Gehirn hat.
- Glycin: An der Bildung von Kollagen, Glutathion und Hämoglobin beteiligt. Relevant bei der Regulierung von Entzündungen und Unterstützung des Zentralnervensystems.
- Prolin: Struktureller Bestandteil von Kollagen, dem Hauptprotein in Bindegewebe, Haut, Knorpel und Knochen. Relevant bei der Wundheilung und Gesundheit der Haut.
- Serin: An der Synthese von Proteinen, Phospholipiden (Bausteinen von Zellmembranen) und Neurotransmittern beteiligt. Relevant bei der Zellproliferation und der Immunantwort.
- Tyrosin: Vorläufer für die Synthese von Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin, die die Stimmung und den Energiehaushalt regulieren. Kann auch zur Bildung von Schilddrüsenhormonen beitragen.
EAA & BCAA: Der Unterschied zwischen EAA und BCAA ist funktional und strukturell – beide Begriffe beziehen sich auf essentielle Aminosäuren, aber BCAA sind eine spezielle Untergruppe der EAA. Ein Unterschied wird gemacht, weil sie im Körper anders wirken und verarbeitet werden.
|
|
EAA (Essential Amino Acids) |
BCAA (Branched-Chain Amino Acids) |
|
Anzahl |
9 |
3 (Leucin, Isoleucin, Valin) |
|
Struktur |
Verschiedene Seitenketten |
Verzweigte Seitenketten |
|
Funktion |
Aufbau von Proteinen, Hormonbildung, Immunabwehr etc. |
Fokus auf Muskelaufbau, Energieversorgung bei Belastung |
|
Verstoffwechselung |
Vor allem in der Leber |
Direkt in der Muskulatur |
|
Ziel |
Allgemeiner Muskelaufbau, essentielle Nährstoffversorgung |
Sport, Muskelregeneration, antikatabole Wirkung |
Proteinqualität: Pflanzliche Proteine haben tendenziell eine geringere anabole Qualität als tierische, vor allem wegen ihres Aminosäureprofils. Durch Kombination / gezielte Auswahl kann dieser Unterschied teilweise oder sogar vollständig ausgeglichen werden.
- Aminosäureprofil:
- Tierische Proteine (z.B. aus Fleisch, Eiern, Milch) enthalten alle essentiellen Aminosäuren in ausreichender Menge – sie gelten als vollwertige Proteine.
- Pflanzliche Proteine (z.B. aus Hülsenfrüchten, Getreide) sind oft in einer / mehreren essentiellen Aminosäuren limitiert.
- Biologische Wertigkeit / Verdaulichkeit: Tierische Proteine haben oft eine höhere biologische Wertigkeit, d.h. der Körper kann sie effizienter nutzen.
- Ausgleich durch Kombination:
- Durch Kombination pflanzlicher Proteinquellen kann ein vollständiges Aminosäureprofil erreicht werden.
- Auch durch pflanzliche Proteinpulver (z.B. aus Erbse, Reis, Hanf, Kürbiskernprotein, etc.) kann ein vollständiges Aminosäureprofil erreicht werden.
- Jedes Protein besteht aus essentiellen + nicht-essentiellen Aminosäuren in unterschiedlichen Mengen.
- Um ein Protein vollständig aufzubauen, benötigt der Körper alle essentiellen Aminosäuren in ausreichender Menge.
- Wenn eine essentielle Aminosäure in einem Lebensmittel zu wenig vorhanden ist (limitierende Aminosäure), wird die Proteinsynthese gestört, und der Körper kann das Protein nicht vollständig verwenden.
- Durch verschiedene Proteinquellen – die unterschiedliche Aminosäureprofile haben – kann der Körper jedoch alle essentiellen Aminosäuren erhalten und die Proteinsynthese optimal unterstützen.
- Es ist nicht zwingend erforderlich, verschiedene Proteinquellen in derselben Mahlzeit zu kombinieren. Es genügt, wenn sie über den Verlauf eines Tages (24 Stunden) hinweg konsumiert werden.
Proteinmangel: Bei Proteinmangel beginnt der Körper, zuerst weniger lebenswichtige / weniger beanspruchte Muskelmasse abzubauen, um Aminosäuren für wichtige Funktionen bereitzustellen.
Der Körper priorisiert den Erhalt von Organfunktionen (z.B. Leber, Gehirn, Herz) und die Versorgung mit Aminosäuren für Immunabwehr, Enzyme, Hormone, etc. Mögliche Reihenfolge beim Muskelabbau:
- Skelettmuskulatur z.B. wenig genutzte Muskeln in Armen / Beinen bei Inaktivität
- Bei schwerem Mangel können auch lebenswichtige Muskelgruppen betroffen sein, z.B. Atemmuskulatur oder Herzmuskel → lebensgefährlich!
Proteinmangel kann erhebliche Auswirkungen haben, da Proteine für zahlreiche lebenswichtige Funktionen unerlässlich sind. Beispiele:
- Muskelschwäche: Bei Mangel baut der Körper Muskeln ab, um Aminosäuren zu gewinnen → Schwäche / Muskelverlust.
- Schwaches Immunsystem: Das Immunsystem ist stark von Proteinen abhängig:
- Antikörper, Immunzellen, Signalstoffe (Zytokine) bestehen größtenteils aus Protein → erhöhte Anfälligkeit für Infektionen, Erkältungen, Entzündungen.
- Wundheilung: Proteinmangel kann die Wundheilung verlangsamen, das Risiko für Infektionen / erhöhen.
- Haarausfall / dünnes Haar / brüchige Nägel: Proteinmangel kann dazu führen.
- Ödeme (Wassereinlagerungen): Proteinmangel kann die Flüssigkeitsregulation stören und Wassereinlagerungen in Beinen / Füßen verursachen.
- Hormonelle Störungen: Proteinmangel kann das hormonelle Gleichgewicht stören. Beispiele:
- Schilddrüsenhormone: Stoffwechselverlangsamung, Gewichtszunahme, Kälteempfindlichkeit.
- Insulin: gestörte Blutzuckerregulation, Heißhunger auf Kohlenhydrate.
- Geschlechtshormone: Zyklusstörungen bei Frauen, Libidoverlust oder Fruchtbarkeitsprobleme.
- Erschöpfung / Müdigkeit:
- Der Körper kann weniger Sauerstoff / Nährstoffe effizient verarbeiten, was zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen, allgemeiner Schwäche führen kann.
- Zudem fehlen wichtige Aminosäuren zur Bildung von Neurotransmittern (z.B. Dopamin, Serotonin), die für Wachheit, Motivation, Stimmung entscheidend sind.
- Schlafhaushalt: Ein Mangel beeinflusst den Schlaf auf biochemischer Ebene:
- Aminosäuren wie Tryptophan sind Vorstufen von Serotonin / Melatonin → Hormone für Entspannung / Schlafrhythmus → Ein- / Durchschlafprobleme.
- Blutzuckerschwankungen durch unzureichende Proteinzufuhr (+ zu viele Kohlenhydrate) können zu Aufwachen / unruhigem Schlaf führen.
- Heißhungerattacken & Gewichtszunahme:
- Bei Proteinmangel sinkt die Sättigung nach Mahlzeiten → häufiges „Snacken“ / Hunger auf Süßes.
- Zu wenig Protein, zu viele einfache Kohlenhydrate → Insulinspitzen → Abfall → Heißhunger.
- Verlust an Muskelmasse: Grundumsatz sinkt, da Muskeln Energie verbrauchen → Gewichtszunahme trotz gleicher Kalorienzufuhr.
- Körperfettzunahme: Bei Proteinmangel, lagert der Körper Energie eher als Fett ein.
- Typisch: Appetit auf salzige / proteinreiche Speisen → „Alarmreaktion“ bei Proteinmangel.
- Richtwerte für eine gesunde, normalgewichtige Person mit moderater Bewegung und Alltagssport:
- Etwa 0,8 g – 1,2 g Protein pro KG Körpergewicht pro Tag.
- Über 2 g/KG/Tag gilt als zu hoch ohne intensives Krafttraining oder Ausdauersport.
- Kurzfristig (über 2 g/KG/Tag)
- Meist harmlos, wenn man genügend trinkt und sonst ausgewogen isst.
- Überschüssiges Protein wird abgebaut und über Leber / Nieren ausgeschieden.
- Langfristig (über 2 g/KG/Tag)
- Belastung der Nieren: Nieren müssen mehr Stickstoff (aus dem Proteinabbau) über den Urin ausscheiden. Bei gesunden Nieren meist kein Problem, bei Nierenerkrankungen kann das schädlich sein.
- Erhöhter Wasserbedarf / Flüssigkeitsverlust: Mehr Proteinabbau → mehr Harnstoff, der über Urin ausgeschieden werden muss → mehr trinken nötig. Zu wenig Flüssigkeit → Austrocknung.
- Kalziumverlust über den Urin: Hoher Proteinkonsum → kann die Kalziumausscheidung erhöhen → langfristig evtl. Risiko für Osteoporose.
- Gewichtszunahme: Wenn übermäßig viel Protein gegessen wird und es den Bedarf übersteigt, wird auch Protein als Fett gespeichert.
- Verdauungsprobleme: Zu viel Protein (besonders aus Shakes / tierischen Quellen) kann zu Blähungen, Durchfall oder Verstopfung führen – v.a. bei zu wenig Ballaststoffen.
- Ungleichgewicht in der Ernährung: Wer zu viel Protein isst, vernachlässigt oft andere wichtige Nährstoffe wie Ballaststoffe, Vitamine oder Kohlenhydrate → unausgewogene Ernährung.
Zufuhrempfehlung – Protein: Richtwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für den Proteinbedarf in g / KG Körpergewicht / Tag:
| Personengruppe | Proteinbedarf | Hinweise |
| Erwachsene (Mischköstler) |
ca. 0,8 | Normale körperliche Aktivität |
| Schwangere | ca. 1,0 | Erhöhter Bedarf durch Wachstum |
| Stillende | ca. 1,1 | Zusätzlicher Bedarf für Milchbildung |
| Senioren (ab 65 Jahren) |
1,0 – 1,2 | Zur Vorbeugung von Muskelabbau (Sarkopenie); reduzierte Proteinresorption |
| Kinder / Jugendliche |
1,0 – 1,5 | Je nach Alter und Wachstumsphase |
| Sportler / körperlich Aktive |
1,2 – 2,0 | Je nach Intensität und Belastung |
Die Fachgesellschaften geben für Veganer keine speziellen Richtwerte vor. Für erwachsene Veganer (normale körperliche Aktivität) wird allgemein eine Aufnahme von 1 g Protein / KG / Tag empfohlen.
Achtung bei Übergewicht: Zur Bedarfsberechnung bei Übergewicht bitte NICHT das aktuelle Körpergewicht, sondern das Idealgewicht verwenden.
Zufuhrempfehlung – Aminosäuren (WHO): Einzig die WHO (Weltgesundheitsorganisation) gibt – weltweit – eine offizielle Zufuhrempfehlung für essentielle Aminosäuren, basierend auf dem Tagesbedarf pro KG Körpergewicht. Diese stammen aus dem WHO/FAO/UNU Report: „Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition“ (PDF, auf Seite 150), veröffentlicht 2007.
- Die WHO-Empfehlungen gelten für gesunde Erwachsene.
- Bei Kindern, Schwangeren oder Kranken kann der Bedarf variieren.
- Die Angabe kombiniert verwandte Aminosäuren (z.B. Methionin + Cystein bilden kann).
- Diese Empfehlungen beziehen sich auf eine optimale Proteinqualität (also leicht verdauliches Protein mit vollständigem Aminosäureprofil, z.B. Ei).
Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) sind der Auffassung, dass es für die meisten Menschen zu kompliziert ist, sich mit dem Bedarf einzelner Aminosäuren auseinanderzusetzen. Daher enthalten deren Proteinzufuhrempfehlungen großzügige Sicherheitspuffer.
Täglicher Bedarf laut WHO (mg pro KG Körpergewicht pro Tag)
- 10 mg – Histidin
- 20 mg – Isoleucin
- 39 mg – Leucin
- 30 mg – Lysin
- 15 mg – Methionin + Cystein
- 25 mg – Phenylalanin + Tyrosin
- 15 mg – Threonin
- 04 mg – Tryptophan
- 26 mg – Valin
Berechnungsformeln:
Individueller Bedarf = Täglicher Bedarf × Körpergewicht (in kg)
Versorgungsanteil (%) = (Menge in Lebensmittel / Individueller Bedarf) × 100
Beispiel: Leucin-Gehalt in 1 Ei (60 g) ca. 0,54 g / Person wiegt 70 kg
Individueller Bedarf = 39 mg x 70 kg = 2730 mg = 2,73 g / Tag
Versorgungsanteil (%) = (0,54 g / 2,73 g) × 100 ≈ 19,8 %
Ein Ei deckt etwa 20 % des Leucin-Bedarfs bei 70 kg Körpergewicht.
Aminosäurebedarf heute vermutlich höher als 2007:Die Aminosäure-Empfehlungen der WHO von 2007 sind heute vermutlich zu niedrig angesetzt, da sie weder die gestiegene Umweltbelastung noch die Verschlechterung von Ernährung und Gesundheitszustand berücksichtigen. Angesichts genannter Belastungsfaktoren ist bei vielen Menschen heute ein deutlich höherer Bedarf an Aminosäuren – und Proteinen insgesamt – zu erwarten.
Das bedeutet konkret: Die WHO-Werte sind Mindestwerte für Gesunde unter Idealbedingungen – sie bilden keine Obergrenze. In der Praxis kann der Bedarf deutlich höher liegen, z.B. bei:
- Veganer mit geringer biologischer Wertigkeit der Proteine
- Ältere Menschen (wegen schlechterer Verwertung)
- Menschen mit chronischen Belastungen / Darmproblemen
- Sportlich Aktiven oder Stressgeplagten
Aminosäurengehalt in Lebensmitteln: Der Aminosäurengehalt in Lebensmitteln bzw. die Angaben auf Verpackungen können durch verschiedene Faktoren variieren. Beispiele:
- Genetische Unterschiede (Sorten/Arten): Unterschiedliche Pflanzen- / Tierarten haben verschiedene Proteinzusammensetzungen.
- Anbaubedingungen / Fütterung: Bodenqualität, Dünger, Klima, Wasserangebot beeinflussen den Nährstoffgehalt. Bei Tieren: Art des Futters.
- Reifegrad / Erntezeitpunkt: Früh oder spät geerntete Pflanzen haben Unterschiede in der Proteinqualität / – quantität.
- Verarbeitung / Herstellung: Hitze, Trocknung, Extraktion (z.B. bei Proteinpulvern) kann Aminosäuren zerstören / verändern.
- Lagerung: Oxidation bei langer Lagerung (z.B. von Samen, Nüssen) kann den Aminosäurengehalt mindern.
- Entölung / Teilentfettung: Bei Produkten wie Kürbiskernprotein wird das Öl entfernt – dabei können sich Aminosäureverhältnisse / – konzentrationen ändern.
- Veredelung (z.B. Fermentation): Fermentationsprozesse (z.B. Tempeh, Sauermilchprodukte) können Aminosäuren abbauen oder auch neu aufbauen.
- Analyse- / Messmethoden
Resorption (Aufnahme): Die Resorption von Aminosäuren (wie gut sie vom Darm ins Blut aufgenommen werden) hängt im Körper von mehreren Faktoren ab. Beispiele:
- Art des Proteins:
- Tierische Proteine (z.B. aus Fleisch, Eiern, Milch) werden meist besser verwertet als pflanzliche.
- Pflanzliche Proteine können unvollständig (nicht alle essentiellen Aminosäuren sind ausreichend enthalten) oder schlechter verdaulich sein.
- Zusammensetzung der Mahlzeit:
- Ballaststoffe, Fett oder bestimmte Pflanzenstoffe können die Aufnahme verlangsamen / behindern.
- Eine ausgewogene Mahlzeit (mit etwas Fett und Kohlenhydraten) kann die Aufnahme verbessern.
- Bedarf des Körpers: Wenn der Körper mehr Protein braucht (z.B. bei Wachstum, Krankheit, nach Sport), nimmt er Aminosäuren effizienter auf.
- Gesundheit des Darms:
- Darmkrankheiten (z.B. Zöliakie, Morbus Crohn) können die Aufnahme von Aminosäuren stören.
- Ein ungleiches Darmmilieu (z.B. durch Antibiotika, schlechte Ernährung) kann die Verwertung beeinflussen.
Resorption am Beispiel von Tofu
- Proteinstruktur / Verarbeitung:
- Rohes / wenig verarbeitetes Protein (z.B. frischer Tofu) ist leichter aufspaltbar.
- Stark erhitzter, geräucherter, gepresster Tofu hat festere Proteinstrukturen → kann die Verdaulichkeit / Resorptionsrate senken.
- Antinährstoffe in Pflanzen:
- Tofu (aus Soja) enthält noch kleine Mengen Inhibitoren (hemmende Stoffe für Proteinverdauung).
- Inhibitoren können die Aktivität der Protein-abbauenden Enzyme verlangsamen.
- Ballaststoffe / Matrixeffekte:
- Tofu enthält moderate Mengen an Ballaststoffen.
- Ballaststoffe können die Verdauung verlangsamen und so auch die Freisetzung der Aminosäuren verzögern.
- Kombination mit anderen Lebensmitteln: Fett / Ballaststoffe (z.B. Tofu mit viel Gemüse und Öl) können die Magenentleerung verlangsamen → Aminosäuren werden langsamer / gleichmäßiger aufgenommen.
- Individuelle Faktoren:
- Alter: Ältere Menschen absorbieren Proteine etwas schlechter.
- Darm: Entzündungen / ein gestörter Darm (z.B. bei Reizdarm) können die Resorption reduzieren.
- Hormone: Insulin & Wachstumshormon fördern die Aufnahme / Nutzung der Aminosäuren.
- Zubereitungsmethode:
- Gekochter / gedämpfter Tofu hat eine bessere Aminosäurenfreisetzung als frittierter Tofu.
- Langsames Garen schont empfindliche Aminosäuren wie Tryptophan.
Proteinreise durch den Körper: Der Weg vom Protein – von der Nahrung bis in die Zelle:
- Mund: Zerkleinert das Protein mechanisch.
- Magen:
- Magensäure entfaltet (denaturiert) die Proteinstruktur.
- Enzym Pepsin beginnt den Abbau von Proteinen in kleinere Stücke (Peptide).
- Dünndarm:
- Bauchspeicheldrüse liefert Enzyme, die Peptide weiter abbauen.
- Am Ende entstehen freie Aminosäuren und kleine Peptide.
- Aufnahme ins Blut (Dünndarmwand):
- Aminosäuren werden aktiv durch die Darmwand ins Blut aufgenommen.
- Über die Pfortader gelangen sie zur Leber.
- Leber – Zentrale Verteilstation: Aminosäuren werden hier
- als Energiequelle genutzt
- vorübergehend im Aminosäuren-Pool gehalten (Blut & Gewebe)
- an andere Organe weitergegeben
- Körperzellen (z.B. Muskeln, Haut, Organe):
- Zellen nehmen Aminosäuren auf und bauen daraus eigene Proteine (z.B. Muskelfasern, Enzyme, Hormone).
- Überschuss wird abgebaut → Ammoniak → Harnstoff → Niere → Urin
Aminosäureabbau: Zentraler Stoffwechselprozess, der auch den Säure-Basen-Haushalt beeinflusst.
- Desaminierung: Beim Aminosäureabbau entstehen Ammoniak (giftig) und organische Säuren.
- Säurebelastung: Diese Säuren können den Körper belasten, wenn kein Ausgleich erfolgt, z.B. durch basenbildende Mineralstoffe oder Gemüse. Eine ausgewogene Ernährung gleicht das i.d.R. gut aus.
- Harnstoffzyklus: Die Leber wandelt Ammoniak in Harnstoff um, der über den Urin ausgeschieden wird.
- Energiegewinnung: Der verbleibende Kohlenstoffanteil der Aminosäure kann in Energie, Zucker oder Fett umgewandelt werden.
Konkurrenz zwischen Aminosäuren: Aminosäuren nutzen spezielle Transportsysteme, um vom Darm ins Blut zu gelangen. Viele dieser Transporter befördern nicht nur eine einzige Aminosäure, sondern ganze Gruppen mit ähnlicher Struktur – z.B. die verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs). Wenn jedoch sehr viel von einer bestimmten Aminosäure zugeführt wird – etwa durch Nahrungsergänzung – kann die Aufnahme anderer blockiert / verlangsamt werden. Mögliche Folgen:
- Ungleichgewichte im Aminosäureprofil
- Beeinträchtigung der Proteinsynthese
-
Nervensystem, Immunsystem oder Hormonproduktion können betroffen sein
Magensäuremangel: (Hypochlorhydrie) kann durch verschiedene Ursachen entstehen. Beispiele:
- Alter: Mit zunehmendem Alter nimmt die Magensäureproduktion bei vielen ab.
- Stress: Kann die Verdauungsfunktion hemmen und die Säureproduktion drosseln.
- Medikamente
- Infektion: Z.B. Helicobacter pylori können die Magenschleimhaut schädigen und die Säureproduktion langfristig verringern.
- Autoimmunerkrankungen: Z.B. autoimmune Gastritis, bei der säurebildende Zellen (Belegzellen) zerstört werden.
- Nährstoffmängel: Z.B. Zink- / Vitamin-B-Komplex-Mangel, die für die Säureproduktion wichtig sind.
- Ernährungsgewohnheiten: Zu viele verarbeitete Lebensmittel, zu wenig Proteine / Bitterstoffe, hastiges Essen, wenig Kauen.
Bei Magensäuremangel können folgende Probleme auftreten:
- Protein‑Verdauung: Magensäure entfaltet (denaturiert) Proteinstrukturen, damit Enzyme sie aufspalten können.
- Ohne ausreichende Säure
- bleiben Proteine „gefaltet“ und schwer zugänglich für Pepsin
- entsteht weniger Pepsin, also weniger Proteinspaltung in kürzere Peptide
- Weniger Spaltung → weniger freie Aminosäuren für Aufbau / Reparatur (Muskel, Enzyme, Hormone).
- Große Proteinfragmente gelangen in den Dünndarm. Dort können sie
- Blähungen / Völlegefühl verursachen
- Allergien / Unverträglichkeiten fördern (das Immunsystem reagiert auf unvollständig zerlegte Proteinbruchstücke).
- Ohne ausreichende Säure
- Nährstoff‑Mängel wie Eisen, Zink, Calcium, Folsäure, etc.
- Vitamin B12: Kann nicht freigesetzt werden → Müdigkeit, Blutarmut, Nervenschäden.
- Mehr Infekte im Darm
- Weniger Säure → weniger Schutz vor Keimen.
- Bakterien können sich stärker vermehren → Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall.
- Sodbrennen trotz wenig Säure
- Niedriger Säure‑Spiegel kann den Verschluss zum Speiseröhrenanfang lockern → Magensaft fließt zurück → Brennendes Gefühl.
Hormone brauchen Proteine – täglich: Hormone steuern fast alle lebenswichtigen Prozesse im Körper. Viele dieser Botenstoffe bestehen aus Aminosäuren oder benötigen sie als Ausgangsstoff. Ein Mangel an Proteinen / Aminosäuren kann die Hormonproduktion stören – mit spürbaren Folgen für Körper und Psyche. Steroidhormone wie Kortisol, Testosteron, Östrogen, Progesteron basieren auf Cholesterin (nicht auf Aminosäuren). Alle anderen Hormone bestehen aus Aminosäuren (meist als Peptidhormone / Derivate).
Tabelle zentraler Hormone: *A=Tyrosin-Derivat *B=Tryptophan-Derivat AS=Aminosäuren
| Hormon | Typ / Ursprung | Bildungsort | Funktion | Thema bei |
| Adrenalin / Noradrenalin | Amin *A | Nebenniere | Kampf-/Flucht-Reaktion, erhöht Puls, erweitert Bronchien | Panikattacken, Sport, Nervosität |
| Oxytocin Kuschelhormon |
Peptid (9 AS) | Hypothalamus (Freisetzung über Hypophyse) | Bindung, Wehen, Milchfluss | Geburt, Stillzeit, zwischenmenschlicher Nähe |
| Kortisol Stresshormon |
Steroid | Nebennierenrinde | Stressreaktion, erhöht Blutzucker, wirkt entzündungshemmend, Schlaf-Wach-Rhythmus | Burnout, Bauchfett, Schlafmangel |
| Serotonin Glückshormon |
Amin *B | Darm, Gehirn | Stimmung, Schlaf, Appetit | Depressionen, Antidepressiva |
| Dopamin | Amin *A | Mittelhirn | Motivation, Antrieb, Belohnung | Sucht, Erfolgserlebnisse, Antriebslosigkeit |
| Melatonin Schlafhormon |
Amin *B | Zirbeldrüse | Schlaf-Wach-Rhythmus | Schlafprobleme, Jetlag, Blaulicht (Bildschirme) |
| Insulin | Peptid (51 AS) | Bauchspeicheldrüse (Langerhans-Inseln) | Senkt Blutzucker, Glukoseaufnahme in Zellen | Diabetes, Low-Carb, Abnehmen, Zuckerkonsum |
| IGF-1 | Proteinhormon | Leber (angeregt durch Wachstumshormone) | Fördert Zellwachstum, Regeneration, Gewebeaufbau. | Muskelaufbau, Wachstum, Anti-Aging, Krebsforschung |
| Glukagon | Peptid (29 AS) | Bauchspeicheldrüse | Erhöht Blutzucker, Gegenspieler von Insulin | Diabetes, Fasten, Low-Carb, Blutzuckerregulation |
| Leptin / Ghrelin | Leptin: Protein / Ghrelin: Peptid |
Fettgewebe / Magen | Appetitregulation (Leptin hemmt, Ghrelin fördert) | Diäten, Adipositas, Essverhalten, Sättigungsgefühl |
| Thyroxin (T4) / Trijodthyronin (T3) | Amin *A | Schilddrüse | Grundumsatz, Energie- / Stoffwechsel | Müdigkeit, Gewichtszunahme, Kälteempfindlichkeit, Schilddrüsenerkrankungen |
| Testosteron | Steroid | Hoden, Nebennieren | Männliche Sexualentwicklung, Libido, Muskelaufbau | Sport, Fitness, Anti-Aging, Männlichkeit |
| Östrogen / Progesteron | Steroid | Eierstöcke | Zyklusregulation, Schwangerschaftsvorbereitung | Zyklusbeschwerden, Wechseljahre, Hormonersatztherapie |
Männliche Potenz braucht Proteine: Aminosäuren können eine positive Wirkung auf die männliche Potenz, Libido und Fruchtbarkeit haben – meist über Durchblutung, Hormonregulation oder Spermienqualität. Beispiele:
- L-Arginin: Vorstufe von Stickstoffmonoxid (NO). NO wirkt gefäßerweiternd (vasodilatierend). Erhöht die Durchblutung, auch im Genitalbereich. Wirkungsverstärker:
- Pycnogenol (Pinienrindenextrakt): Verstärkt NO-Freisetzung → bessere Durchblutung
- Zink: Wichtig für Testosteronproduktion → ergänzt die gefäßaktive Wirkung
- Vitamin C + E: Stabilisieren NO im Blut, wirken antioxidativ
- Folsäure, B6, B12: Unterstützen Homocystein-Stoffwechsel und Gefäßgesundheit → indirekte Unterstützung
- Traubenkernextrakt (OPC): Stärkt Endothelfunktion → bessere Reaktion auf NO
- L-Citrullin: Wird im Körper zu Arginin umgewandelt – teils wirksamer als Arginin selbst. Wirkungsverstärker: Siehe L-Arginin.
- L-Tyrosin: Vorstufe von Dopamin. Fördert Lust, Motivation, sexuelles Verlangen. Wirkungsverstärker:
- Vitamin B6: Cofaktor für die Umwandlung zu Dopamin
- Vitamin C: Stabilisiert Dopamin, schützt vor oxidativem Abbau
- Rhodiola rosea / Ginseng: Pflanzenstoffe, die ebenfalls Motivation und Libido fördern
- Magnesium: Unterstützt Nervenfunktionen, Dopaminhaushalt
- L-Carnitin (besonders Acetyl-L-Carnitin): Unterstützt Energieproduktion in den Zellen, verbessert Spermienbeweglichkeit. Wirkungsverstärker:
- Coenzym Q10: Ergänzt Carnitin bei der Energieproduktion in den Mitochondrien
- Vitamin B5 (Pantothensäure): Fördert die Bildung von Acetyl-CoA – wichtig für Carnitin-Stoffwechsel
- Selen & Zink: Wichtig für Spermienqualität, ergänzen die Wirkung bei Fruchtbarkeit
- Taurin: Unterstützt Kreislauf / Herzfunktion. Indirekt vorteilhaft für Erektionsfähigkeit. Wirkungsverstärker:
- Magnesium / Kalium: Taurin wirkt u. a. über diese Elektrolyte → Herz-Kreislauf-Stabilität
- Omega-3-Fettsäuren: Unterstützen Herzgesundheit und Gefäßfunktion
- Vitamin B6: Fördert die Taurin-Synthese aus Cystein (wenn nicht supplementiert)
- D-Asparaginsäure (DAA): Kann Testosteron / LH-Spiegel kurzfristig steigern (kein Dauergebrauch empfohlen). Wirkungsverstärker:
- Zink: Wichtig für Testosteronproduktion – ergänzt DAA optimal
- Vitamin D3: Reguliert Testosteronspiegel
- Ashwagandha: Adaptogen, kann DAA-Wirkung auf Testosteron verstärken
- Bor: Fördert freien Testosteronspiegel in Kombination mit DAA
Anabol & Katabol: Die Begriffe stammen aus dem Stoffwechsel (Metabolismus) und beschreiben zwei gegensätzliche Prozesse im Körper.
- Anabol = Aufbau (A wie Aufbau): Der Körper baut etwas auf, z.B. Zellen.
- Katabol = Abbau (K wie Kaputtmachen): Der Körper baut etwas ab, z.B. um Energie zu gewinnen.
Anabole Prozesse bauen komplexe Moleküle aus einfachen Bausteinen auf. Dabei wird Energie verbraucht. Essenzielle Aminosäuren liefern Bausteine und Cofaktoren für Proteine, Enzyme, Neurotransmitter und Entgiftungs‑Mechanismen. Beispiele:
- Muskelaufbau (Muskelproteinsynthese)
- Glykogenaufbau aus Glukose
- Fettreservenaufbau aus Fettsäuren
- Proteinsynthese aus Aminosäuren
- Steuernde Hormone z.B. Insulin, Testosteron, Wachstumshormon
Katabole Prozesse bauen komplexe Moleküle zu einfacheren ab, um Energie / Glukose zu generieren. Beispiele:
- Fettverbrennung (Lipolyse)
- Glykogenabbau zu Glukose (Glykogenolyse)
- Proteinabbau (z.B. bei Fasten oder Stress)
- Zellatmung (Glukoseabbau zur Energiegewinnung)
- Steuernde Hormon z.B. Adrenalin, Cortisol, Glukagon
Proteinspeicher: Proteine können im Körper nicht direkt gespeichert werden – wie Fett oder Kohlenhydrate. Der Körper hat einen begrenzten Aminosäuren-Pool im Blut und Gewebe – eine Art kurzfristiger Speicher, der ständig durch Nahrungsaufnahme und Abbau ersetzt wird. Das ist jedoch kein echter Speicher, sondern eher ein dynamischer Kreislauf.
- Überschüssige Aminosäuren werden nicht gespeichert, sondern:
- Ihre Aminogruppen werden abgespalten (Desaminierung)
- Stickstoff wird in Leber zu Harnstoff umgewandelt und über die Nieren ausgeschieden
- Kohlenstoffanteil kann zur Energiegewinnung genutzt oder in Fett umgewandelt werden
Da der Körper keine direkten Proteinspeicher hat, ist eine tägliche Proteinzufuhr essentiell. Fehlt Protein, greift der Körper auf Muskelmasse zurück, um Aminosäuren bereitzustellen – das kann zu Schwäche und Muskelabbau führen.
- Warum Muskeln nicht als Proteinspeicher dienen:
- Muskeln sind funktionelles Gewebe: Sie bestehen aus struktur- / kontraktionsfähigen Proteinen, die für Bewegung, Haltung, Atmung und viele Stoffwechselprozesse gebraucht werden.
- Kein gezielter Ab- und Wiederaufbau: Anders als Fett / Glykogen kann Muskelprotein nicht einfach „eingelagert und bei Bedarf abgerufen“ werden, ohne Funktion einzubüßen.
-
Abbau ist eine Notmaßnahme: Der Körper baut Muskelgewebe nur im Notfall ab, z.B. bei längerem Fasten, Krankheit oder Proteinmangel.
Kollagen: Häufigstes Strukturprotein im menschlichen Körper, macht etwa 30 % aller Proteine aus. Mit zunehmendem Alter nimmt die körpereigene Kollagenproduktion ab – was zu Falten, schwächerem Bindegewebe und Gelenkproblemen führen kann.
- Es ist ein faserförmiges Protein, das Gewebe fest, elastisch und widerstandsfähig macht.
- Kollagen ist ein Hauptbestandteil von Haut, Knochen, Sehnen, Knorpel und Bindegewebe.
- Der Körper bildet Kollagen selbst, vor allem aus den AS Glycin, Prolin, Hydroxyprolin – mit Hilfe von Vitamin C.
- Gibt Haut ihre Spannkraft
- Stabilisiert Gelenke und Knochen
- Unterstützt Wundheilung und Zellstruktur
Vegane Kollagen-Quellen: Es gibt keine pflanzlichen Quellen von Kollagen, da Kollagen ein tierisches Strukturprotein ist, das ausschließlich in Tieren (z. B. in Haut, Knochen und Bindegewebe) vorkommt.
Aber es ist möglich, die körpereigene Produktion durch vegane Ernährung zu fördern oder auf technisch hergestellte vegane Kollagenprodukte zurückzugreifen.
Einige Hersteller bieten biotechnologisch hergestelltes veganes Kollagen an, das z.B. mithilfe von Hefen / Bakterien in einem Fermentationsprozess produziert wird.
- Fördern die körpereigene Kollagenbildung:
- Vitamin C
- Aminosäuren wie Glycin, Prolin, Hydroxyprolin – aus pflanzlichen Quellen wie Hülsenfrüchte, Soja, Quinoa
- Zink / Kupfer z.B. aus Nüssen, Vollkorn, Hülsenfrüchten
- Silizium (Kieselsäure) z.B. aus Hirse
Weizenprotein: kommt hauptsächlich in Produkten aus Weizenmehl vor und besteht hauptsächlich aus zwei Proteinfraktionen: Glutenin (wasserunlöslich) + Gliadin (alkohollöslich).
Beiden zusammen bilden Gluten, auch bekannt als „Klebereiweiß“. Selbst wenn ein Produkt nicht offensichtlich aus Weizen besteht, kann Weizenprotein als Zusatzstoff / technologischer Hilfsstoff enthalten sein. Beispiele:
- Brot, Brötchen, Brezeln, Croissants, Kuchen, Gebäck
- Pasta, Pizza, Fertiggerichte, Panaden
- Seitan, Frühstückscerealien, Müsliriegel
- Soßen, Verdickungsmittel, Suppenpulver, Würzmischungen
- Fleischersatzprodukte, vegane Wurst,
- Süßigkeiten
- Vorteile:
- Technologisch vielseitig einsetzbar: Sorgt für Klebereigenschaften, Elastizität, Teigstruktur
- Pflanzliches Protein mit guter Funktionalität
- Reich an Glutamin (für Muskel- / Darmzellen wichtig)
- Hoher Anteil an Prolaminen / Gluteninen (→ Glutenbildung)
- Hoher Proteinanteil
- Weizenprotein-Isolat: bis zu 80–90 % Protein
- Günstige Proteinquelle (z.B. in veganen Produkten)
- Nachteile – Gesundheitliche Risiken, mögliche Reaktionen:
- Prolamine sind eine bestimmte Gruppe von Getreide–Proteinen, die vor allem in Samen wie Weizen, Roggen, Gerste und Mais vorkommen. Sie sind reich an bestimmten Aminosäuren (z.B. Prolin und Glutamin) und schwer verdaulich. Jede Getreideart hat ihre eigene Form von Prolaminen.
- Gliadine sind die Prolamine im Weizen. Sie machen etwa 40–50 % des Weizenproteins aus.
Prolamine, insbesondere Gliadine, können für den Menschen aus mehreren Gründen problematisch sein — vor allem im Zusammenhang mit Zöliakie, Weizenallergie und Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität (NCWS).
Der Hauptgrund liegt in ihrer Struktur und der Reaktion des Immunsystems darauf.
- Zöliakie (Autoimmunerkrankung): Auslöser Gliadin
- Problem: Gliadin enthält bestimmte Peptidabschnitte, die:
- im Dünndarm nicht vollständig abgebaut werden
- die Darmbarriere durchdringen können („Leaky Gut“)
- vom Immunsystem als fremd erkannt werden
- Mögliche Folgen:
- Autoimmunreaktion gegen die Dünndarmschleimhaut
- Entzündung, Rückbildung der Darmzotten → schlechte Nährstoffaufnahme → Mangelerscheinungen (z.B. Eisen, Vitamin B12)
- Langfristig: Osteoporose, Unfruchtbarkeit, erhöhtes Krebsrisiko (Lymphome)
- Problem: Gliadin enthält bestimmte Peptidabschnitte, die:
- Weizenallergie (klassische IgE-vermittelte Allergie)
- Reaktion auf verschiedene Weizenproteine, darunter auch Prolamine
- Oft bei Kindern, kann aber auch Erwachsene betreffen
- Symptome: Hautausschläge, Atembeschwerden, Verdauungsprobleme, in schweren Fällen allergischer Schock (Anaphylaxie)
- Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität (NCWS)
- Keine Autoimmunreaktion, keine Allergie – aber Beschwerden nach Weizenkonsum
- Ursachen vermutlich vielfältig
- Symptome: Blähungen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit („Brain Fog“), Reizdarmähnliche Symptome
Prolamin / Gliadin – schwer verdaulich
- Hochresistent gegenüber Verdauung → schlecht abbaubar → verbleiben im Darm als immunaktive Peptide
- Teilweise unverdaut verbleibende Fragmente
- Können das Immunsystem aktivieren
- Begünstigen eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut („Leaky Gut“)
- Mögliche Auswirkungen einer gestörten Darmbarriere und chronischer Entzündung
- Reizungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, „Immunstress“
- Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, „Brain Fog“
- Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen
- Vorteile:
- Hochwertiges pflanzliches Protein: Enthält alle 9 essentiellen Aminosäuren
- Hohe biologische Wertigkeit (je nach Verarbeitung)
- Herz-Kreislauf: Kann LDL-Cholesterin senken, Isoflavone (sekundäre Pflanzenstoffe) haben antioxidative Wirkung
- Typische Quellen für Sojaprotein
- Tofu, Tempeh, Sojadrinks, Sojajoghurt
- Sojaprotein-Isolat / Konzentrat: in Proteinpulvern, Riegeln, Fleischersatz
- Versteckt: in Fertigprodukten, Soßen, Backwaren (z.B. als Emulgator, Proteinquelle)
- Nachteile – Gesundheitliche Risiken, mögliche Reaktionen:
- Sojaallergie:
- IgE-vermittelte Allergie auf Sojaprotein
- Oft bei Kindern, kann aber auch Erwachsene betreffen
- Allergiesymptome: Hautausschlag, Atemnot, Magen-Darm-Beschwerden
- Unverträglichkeit: Oligosaccharide (z.B. Raffinose, Stachyose) → Mögliche Symptome: Gärungen im Darm, Blähungen, Völlegefühl, Durchfall
- Hormonähnliche Wirkung durch Isoflavone: Soja enthält Phytoöstrogene, die dem menschlichen Östrogen ähneln
- In sehr hoher Dosis (z.B. bei Nahrungsergänzung) evtl. Einfluss auf Hormonhaushalt
- Besonders relevant bei Schilddrüsenerkrankungen / Hormonsensitivität
- Verarbeitung & Zusatzstoffe: Viele Sojaprodukte (z. B. Sojaprotein-Isolat) sind stark verarbeitet
- Zusatzstoffe, Rückstände (z.B. Lösungsmittel aus der Extraktion) können Reizungen / Unverträglichkeiten auslösen
- Sojaallergie:
- Viele Menschen mit Birkenpollenallergie entwickeln Kreuzreaktionen auf bestimmte pflanzliche Lebensmittel.
- Grund: Die Struktur des Hauptallergens in Birkenpollen (Bet v 1) ähnelt stark Proteinen in anderen Lebensmitteln.
- In Soja ist das entsprechende kreuzreaktive Protein Gly m 4.
- Kreuzreaktion – Häufig bei Erwachsenen
- Oft ohne starke Symptome wie Ausschlag / Atemnot, eher lokale Schleimhautreaktionen: z.B. in Mund, Rachen, Nase.
- Kann auch durch erhitzte Sojaprodukte wie Tofu / Sojaschnetzel ausgelöst werden.
- Typische Symptome
- Kribbeln / Jucken im Mund (klassisch bei rohem Obst, seltener bei Soja)
- Chronisch gereizte Nasenschleimhaut
- Schleimbildung, Schnupfen, Niesreiz
- Manchmal auch leichte Magen-Darm-Beschwerden
- Abklärung
- Test auf Gly m 4 (rekombinantes Soja-Allergen)
- Spezifischer Bluttest, der eine Kreuzallergie zwischen Birke / Soja identifizieren kann.
- Allergologen nach einem Component-Resolved Diagnostics (CRD)-Test fragen.
- Sojaverzicht für 2–3 Wochen: Kann zeigen, ob Soja Auslöser ist.
- Alternative Proteinquellen: Kichererbsen, Bohnen, Linsen, Lupinen (kann auch kreuzreagieren), Hanfprotein, Erbsenprotein, Hafer, Quinoa, Nüsse, etc.
- Test auf Gly m 4 (rekombinantes Soja-Allergen)
Isolierte Aminosäuren: Aminosäuren können dem Körper entweder in isolierter Form oder als Di-/Tripeptide zugeführt werden.
| Eigenschaft | Isolierte Aminosäuren | Di-/Tripeptide |
| Bausteine | Einzelne Aminosäuren | 2–3 verbundene Aminosäuren |
| Aufnahme | Aminosäure-Transporter | Peptidtransporter (PEPT1) |
| Aufnahmeeffizienz | Gut, aber mit Konkurrenz | Sehr effizient |
| Geschwindigkeit | Hoch | Sehr hoch |
| Einsatzbereiche | Nahrungsergänzung, Medizin | Medizin, Sport, intravenöse Ernährung |
| Vorteil | Gezielte Zufuhr möglich | Schneller Transport, weniger Konkurrenz |
| Nachteil | Transport-Konkurrenz | Nicht gezielt steuerbar |
| Preis | Relativ niedrig, z.B. < 1 €/g | Deutlich höher, oft > 10 €/g |
Nachfolgend geht es um isolierte Aminosäuren: Die Resorption (Aufnahme) hängt von mehreren Faktoren ab – z.B. Dosis, Art der Aminosäuren, Einnahmezeitpunkt (nüchtern oder mit Nahrung).
- Bioverfügbarkeit:
- Isolierte Aminosäuren (Pulverform) müssen – anders als Nahrungsproteine – nicht erst aus Proteinen herausgespalten werden. Sie sind schnell verfügbar und benötigen keine enzymatische Verdauung.
- Die Bioverfügbarkeit (also der Anteil, der wirklich ins Blut geht) liegt für freie Aminosäuren i.d.R. bei über 90 %, sofern keine Krankheiten vorliegen.
- Freie Aminosäuren erreichen ihren Konzentrationshöhepunkt im Blut (Peak) schneller als Protein (ca. 30–60 min nach Einnahme).
- Transporter:
- Es gibt spezifische Transportproteine für verschiedene Klassen von Aminosäuren:
Neutral z.B. Leucin, Valin / Basisch z.B. Lysin, Arginin / Sauer z.B. Glutamat / Aromatisch z.B. Tryptophan - Da verschiedene Aminosäuren häufig dieselben Transportmechanismen nutzen, kann eine hohe Zufuhr einzelner Aminosäuren die Aufnahme anderer behindern.
- Dies kann zu einer verzögerten Resorption, möglichen Unverträglichkeiten (z.B. Blähungen, Durchfall) oder erhöhtem Aminosäureverlust über den Stuhl führen.
- Es gibt spezifische Transportproteine für verschiedene Klassen von Aminosäuren:
- Lösung: Die Aufteilung der Tagesdosis (z.B. 3–5 Einnahmen) verbessert die Gesamtresorption als auch die Verwertung.
„Hohe Zufuhr“
| Supplementierung | Pro Einnahme | Tagesmenge |
| Normale Zufuhr | 02–5 g | 05–15 g/Tag |
| Hohe Zufuhr | 6–10 g | 15–30 g/Tag |
| Sehr hohe Zufuhr | > 10 g | 30–40 g/Tag |
Über 10 g pro Einnahme gelten als kritisch
- Transportersättigung im Dünndarm: Mindert die Resorption und erhöht Verluste.
- Konkurrenz: Strukturell ähnliche Aminosäuren (z.B. BCAAs) konkurrieren um dieselben Transporter.
- Verdauungssymptome: Übelkeit, Blähung, Durchfall bei zu hoher Zufuhr.
- Metabolische Belastung: Leber / Niere müssen den Überschuss abbauen – relevant bei Hochdosis-Zufuhr.
- Die Berechnung des Proteingehalts von Lebensmitteln ist heute deutlich einfacher – dank Herstellerangaben und Apps, die nach Eingabe der Lebensmittelmenge die wichtigsten Nährstoffe anzeigen.
Doch der reine Proteingehalt sagt wenig darüber aus, wie viele Aminosäuren tatsächlich im Darm ankommen und dem Körper zur Verfügung stehen (siehe Abschnitt Resorption). - Proteinsupplemente – ob als Pulver / Kapseln – weisen je nach Hersteller sehr unterschiedliche Aminosäureprofile auf. Eine Zusammensetzung, die optimal den WHO-Empfehlungen entspricht, habe ich bislang nicht gefunden – zudem sind viele Produkte überteuert.
- Eine gezielte Supplementierung mit Aminosäuren kann zur Vorbeugung eines möglichen Proteinmangels sinnvoll sein – beispielsweise bei Krankheiten, Unverträglichkeiten oder in der veganen Ernährung.
- Tipp 1: Isolierte Aminosäuren einzeln kaufen (auch in veganer Qualität) und zu Hause selbst mischen – z. B. nach den WHO-Richtwerten oder dem persönlichen Fitnessbedarf. Das ist deutlich kosteneffizienter.
- Tipp 2: Erstelle Tages- / Wochendosierungen. Wichtig: Die Tagesmenge möglichst auf mehrere Portionen aufteilen – idealerweise nicht mehr als 5 g pro Einnahme, um die Resorption zu optimieren.
Moderner Lebensstil: In unserer industriell geprägten Ernährung und angesichts der steigenden Erkrankungen, beeinflussen folgende Belastungsfaktoren den Aminosäurestoffwechsel erheblich:
- Unausgewogene, nährstoffarme Ernährung und Mikronährstoffmängel
- Umweltgifte / toxische Belastungen (z.B. Pestizide, Mikroplastik, Schwermetalle)
- Akuter / chronischer Stress
- Akute / chronische Erkrankungen
- Entzündungen / Silent Inflammation
- Darmdysbiose / Leaky-Gut-Syndrom
Aminosäuren, die in unserem modernen Lebensstil vermehrt verbraucht oder mangelhaft sein können. Beispiele:
- Essentielle Aminosäuren mit erhöhtem Bedarf
- Tryptophan
- Verbrauch steigt bei: chronischem Stress, Entzündungen, hohem Cortisol.
- Wichtig für: Serotonin- / Melatoninbildung (Stimmung, Schlaf), Immunsystem.
- Problem: Tryptophan wird auch im Kynurenin-Stoffwechsel abgebaut, der bei Entzündung verstärkt aktiv ist – dadurch steht weniger für Serotonin zur Verfügung.
- Methionin
- Verbrauch steigt bei: oxidativem Stress, Leberbelastung.
- Wichtig für: Methylierung, Entgiftung, Bildung von Cystein (Glutathion).
- Problem: Geringe Aufnahme + hoher Verbrauch kann die Entgiftungskapazität beeinträchtigen.
- Phenylalanin
- Verbrauch steigt bei: Stress, entzündlichen Erkrankungen.
- Wichtig für: Bildung von Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin.
- Problem: Mangel kann Antrieb, Stimmung und Stressresistenz negativ beeinflussen.
- Tryptophan
- Nicht-essentielle Aminosäuren mit erhöhtem Bedarf
- Glutamin
- Verbrauch steigt bei: chronischer Entzündung, Darmpermeabilität (Leaky Gut), Immunsystemaktivität.
- Wichtig für: Energiequelle für Darmzellen, Immunzellen, Entgiftung (Ammoniakbindung).
- Oft mangelhaft bei: Autoimmunerkrankungen, Reizdarmsyndrom, Krebs, intensiver Belastung.
- Cystein
- Verbrauch steigt bei: oxidativem Stress.
- Wichtig für: Bildung von Glutathion (wichtigstes zelluläres Antioxidans).
- Eng verknüpft mit: Methionin.
- Glycin
- Verbrauch steigt bei: Entzündungen, schlechter Kollagenbildung, Leberentgiftung.
- Wichtig für: Bildung von Kollagen, Glutathion, Gallensäuren, Beruhigung.
- Problem: In moderner Ernährung oft zu wenig enthalten.
- Tyrosin
- Verbrauch steigt bei: Stress, Schilddrüsenunterfunktion.
- Wichtig für: Dopamin-, Noradrenalin- und Schilddrüsenhormonproduktion.
- Arginin
- Verbrauch steigt bei: chronischer Entzündung, Infektionen, Gefäßstress (z.B. Bluthochdruck), Wundheilung, Stress, intensiver körperlicher Belastung.
- Wichtig für: Bildung von Stickstoffmonoxid (NO) zur Gefäßweitung und Durchblutung, Immunabwehr, Wundheilung, Harnstoffzyklus (Ammoniakentgiftung), Hormonregulation (z.B. Insulin).
- Oft mangelhaft bei: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolischem Syndrom, chronisch-entzündlichen Erkrankungen, postviralen Zuständen (z.B. Long COVID), einseitiger Ernährung.
- Glutamin
Belastungen & Einfluss auf Nährstoff- / Aminosäurebedarf: Unser moderner Lebensstil führt zu einer Vielzahl an Belastungen für den Körper – mit direkten Auswirkungen auf Nährstoffversorgung, Stoffwechsel und den Bedarf an Aminosäuren.
- Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Ernährung
- Industrielle Landwirtschaft: Monokulturen und ausgelaugte Böden verringern die Nährstoffdichte in Pflanzen (weniger Mineralstoffe, Spurenelemente).
- Pestizide (z.B. Glyphosat): Rückstände in Lebensmitteln, potenzielle hormonelle Wirkungen
- Zusatzstoffe: Künstliche Zusätze (Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel) belasten den Stoffwechsel und die Darmflora.
- Tierhaltung: Stress verändert das Nährstoffprofil tierischer Produkte (z.B. Omega-3/6-Verhältnis).
- Verarbeitete Lebensmittel: Hoher Anteil an Zucker, Transfetten, künstlichen Süßstoffen → Förderung von Entzündungen, Insulinresistenz, Darmdysbiose.
- Umweltfaktoren
- Schwermetalle (z.B. Quecksilber, Blei, Cadmium) → Anreicherung in Fischen, Böden, Wasser
- Schadstoffe: Mikroplastik, Medikamentenrückstände (z.B. in Fisch, Wasser, Salz, Böden) belasten Entgiftungsorgane.
- Luft- & Wasserverschmutzung: Stickstoffeintrag und PFAS führen zu weiteren Belastungen.
- Lebensstil & Gesundheit
- Chronischer Stress: Erhöht den Verbrauch an Aminosäuren wie Tryptophan, Tyrosin, Glutamin (für Neurotransmitter, Immunsystem, Cortisolregulation).
- Schlafmangel, Schichtarbeit, Bewegungsmangel, Reizüberflutung: Beeinflussen Hormonhaushalt, verändert Essverhalten, Stoffwechsel und Nährstoffverwertung.
- Medikamente: Langzeitanwendung (Antibiotika, Pille, Säureblocker) schädigt Darmflora und Nährstoffaufnahme.
- Chronische Erkrankungen: Krankheiten wie Diabetes, Autoimmunerkrankungen oder Krebs erhöhen den Bedarf an Proteinen Reparatur- / Immunfunktion.
- Erhöhter Aminosäurebedarf
- Entgiftung: Leber und Nieren benötigen mehr Aminosäuren wie Cystein, Glycin, Glutamin.
- Darm: Dysbiose, Leaky-Gut und Entzündungen erhöhen den Bedarf an Aminosäuren zur Regeneration.
- Proteinqualität: Industrielle Nahrungsmittel enthalten weniger hochwertige, essentielle Aminosäuren.
- Silent Inflammation (stille oder chronische, niedriggradige Entzündungen) können im Körper bestehen, ohne dass sie im kleinen / großen Blutbild direkt auffallen.
- Silent Inflammation ist nicht wie eine akute Infektion
- Sie ist niedriggradig, oft lokal begrenzt und verläuft ohne eindeutige „Gefahrensignale“.
- Das Immunsystem erkennt sie nicht unbedingt als prioritären „Feind“.
- Entzündungsprozesse können sich durch Dysregulation oder dauerhafte Reizung (z.B. durch falsche Ernährung, Stress, Umweltgifte, Dysbiose) chronifizieren.
- Silent Inflammation sind ein häufig unterschätzter Faktor und beeinträchtigen die Gesundheit langfristig auf vielfältige Weise.
Auswirkungen: Selbst eine einzige chronisch stille Entzündung kann den Organismus dauerhaft belasten. Insbesondere, wenn sie vom Immunsystem nicht effektiv reguliert wird. Da sie oft unbemerkt bleibt, kann sich über die Zeit eine systemische Entzündungsbereitschaft entwickeln, die als Risikofaktor für zahlreiche chronische Erkrankungen gilt.
- Atherosklerose / Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Entzündliche Prozesse fördern die Ablagerung von Fett und Immunzellen in den Gefäßwänden.
- Erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Gefäßkrankheiten.
- Typ-2-Diabetes
- Chronische Entzündung verschlechtert die Insulinempfindlichkeit (Insulinresistenz).
- Fördert die Entstehung von Diabetes und erschwert die Blutzucker-Kontrolle.
- Neurodegenerative Erkrankungen
- Silent Inflammation kann Gehirnentzündungen fördern.
- Möglicher Zusammenhang mit Alzheimer, Parkinson und anderen Demenzen.
- Autoimmunerkrankungen
- Dauerhafte Entzündung kann das Immunsystem fehlsteuern.
- Förderung von Krankheiten wie Rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose.
- Chronische Schmerzen / Fibromyalgie
- Entzündliche Prozesse können Schmerzrezeptoren sensibilisieren.
- Verstärkung von chronischen Schmerzsyndromen.
- Fettleibigkeit / metabolisches Syndrom
- Entzündliche Prozesse im Fettgewebe beeinträchtigen den Stoffwechsel.
- Förderung von Übergewicht, Bluthochdruck und erhöhtem Cholesterin.
- Beschleunigte Alterung (Inflammaging)
- Chronische Entzündungen tragen zur Zellalterung bei.
- Erhöhen das Risiko für altersbedingte Krankheiten und Gebrechlichkeit.
- Diagnostik
- Hs-CRP (hochsensitives CRP): Kann geringste Erhöhungen anzeigen, die Standard-CRP nicht erfasst
- Zytokine (z.B. IL-6, TNF-α): Werden im Labor gemessen, sind aber nicht routinemäßig angefordert
- Fibrinogen, Ferritin: Können bei chronischer Entzündung moderat erhöht sein
- Andere spezialisierte Marker (z.B. Lipoprotein(a), Homocystein) je nach Verdacht
Silent Inflammation & Ernährung – Zusammenhang mit latentem Proteinmangel? Ein latenter Proteinmangel könnte ein beitragender Faktor zu Silent Inflammation sein, vor allem wenn dadurch die Immunabwehr und Reparaturmechanismen beeinträchtigt werden.
Die folgenden Faktoren sind nicht nur Auslöser für Störungen im Aminosäurestoffwechsel, sondern gelten auch als zentrale Risikofaktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Silent Inflammation (stillen Entzündungen). Sie wirken teils direkt entzündungsfördernd oder schwächen regulatorische Prozesse im Immunsystem.
- Silent Inflammation entsteht u.a. durch die genannten Belastungsfaktoren sowie:
- Übergewicht / Bewegungsmangel
- Mikroben / chronische Infektionen
- Proteinmangel in der industriellen Ernährung?
- Proteinqualität / Aminosäureprofil (v.a. essentielle AS) können je nach Ernährungsweise schwanken.
- Auch ein Mangel an bestimmten Aminosäuren oder Mikronährstoffen (z.B. Zink, Vitamin D) kann das Immunsystem schwächen und Entzündungen fördern.
- Könnte ein latenter Proteinmangel Silent Inflammation fördern?
- Theoretisch ja, da Proteine / Aminosäuren für die Reparaturprozesse, die Immunfunktion und den Aufbau entzündungshemmender Moleküle essentiell sind.
- Ein subklinischer Mangel an wichtigen Bausteinen könnte das Immunsystem dysregulieren und somit chronische Entzündungen begünstigen.
Aminosäurestatus: Die Bewertung des Aminosäurestatus im Labor erfolgt anhand von Referenzwerten, die aus Blutkonzentrationen „scheinbar gesunder“ Personen ermittelt wurden. Diese Standardwerte spiegeln jedoch nicht zwangsläufig den tatsächlichen Bedarf unter heutigen Lebensbedingungen – sie beruhen auf statistischen Mittelwerten, nicht auf Kriterien optimaler Gesundheit.
- Diagnostik
- Misst die tatsächliche Konzentration von freien Aminosäuren im Blutplasma, Serum oder Vollblut.
- Einheit: typischerweise µmol/l (Mikromol pro Liter).
- Vergleich erfolgt mit Referenzwerten, die laborspezifisch oder auf Basis von Fachgesellschaften erstellt wurden.
- Die Referenzwerte stammen aus Untersuchungen an gesunden Kontrollpersonen.
Blutspiegel sind Momentaufnahmen: Aminosäuren sind sehr dynamisch – sie schwanken je nach: • Tageszeit • letzter Mahlzeit • körperlicher Aktivität • Leberfunktion • Darmgesundheit
Ein „normaler“ Blutwert bedeutet also nicht automatisch, dass der Körper optimal versorgt oder der Bedarf gedeckt ist – v.a. nicht bei genannten Belastungsfaktoren. Denn diese Belastungsfaktoren können den Bedarf an Aminosäuren erhöhen, ohne dass dies in den Blutwerten auffällt – eine latente Unterversorgung bleibt somit oft unerkannt.
Entzündungen – Standard- / Zusatzmarker: Im menschlichen Körper gibt es verschiedene Entzündungsparameter, die bei Verdacht auf eine Entzündung oder Infektion im Blut untersucht werden können. Dabei ist zu unterscheiden, welche standardmäßig untersucht und welche zusätzlich bei Bedarf angefordert werden.
- Kleines Blutbild – Standardwerte
- Leukozyten (weiße Blutkörperchen) – erhöht bei Infektionen / Entzündungen und bei Leukämien
- Erythrozyten (rote Blutkörperchen) – eher bei Anämie relevant
- Hämoglobin (Hb) – Sauerstoffträger, eher zur Anämiediagnostik
- Hämatokrit – Anteil der Zellen am Gesamtblutvolumen
- Thrombozyten (Blutplättchen) – bei Entzündungen teils erhöht
- MCV, MCH, MCHC – geben Hinweise auf Erythrozytenstatus und möglichen B12-Mangel (MCV).
- Großes Blutbild – Kleines Blutbild + Differentialblutbild
- Neutrophile Granulozyten – erhöht bei bakteriellen Infektionen, akuten Entzündungen, Stress, Gewebeschäden.
- Lymphozyten – erhöht bei viralen Infektionen, einigen chronischen Infektionen und lymphatischen Erkrankungen.
- Monozyten – erhöht bei chronischen Entzündungen, bestimmten bakteriellen Infektionen (z.B. Tuberkulose), autoimmunen Erkrankungen und Regenerationsphasen nach Infektionen.
- Eosinophile Granulozyten – erhöht bei Allergien, parasitären Infektionen (z.B. Wurmbefall), bestimmten chronischen Erkrankungen.
- Basophile Granulozyten – erhöht selten, aber bei allergischen Reaktionen, myeloproliferativen Erkrankungen und manchmal bei Entzündungen.
- Spezielle Entzündungsmarker – Keine Standarderfassung, aber häufig angefordert
- CRP (C-reaktives Protein) – sehr empfindlich für akute Entzündungen (steigt schnell an), reagiert jedoch meist nur bei akuten und mittelgradigen Entzündungen.
- BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit) – unspezifisch, steigt bei Entzündungen, dauert aber länger
- Prokalzitonin (PCT) – sehr spezifisch für bakterielle Infektionen und Sepsis
- Fibrinogen – Akute-Phase-Protein, bei Entzündungen erhöht
- Ferritin – Eisenspeicher, aber auch ein Akute-Phase-Protein
- Interleukin-6 (IL-6) – ist bei entzündlichen Prozessen erhöht
GRATIS Download des ganzen Artikels (PDF 22 Seiten)
DOKU-Tipps: 🎦 Video / 📄 Info – Die Reihenfolge ist keine Wertung.
🎦 Mark Warnecke, Arzt & 3x Schwimmweltmeister:
• Aufbau & Heilung: Die essenzielle Bedeutung von Proteinen & Aminosäuren
• Fragen & Antworten zum Thema: Proteine / Eiweiße und Aminosäuren
• Wie Proteine und Aminosäuren Ihre Heilung beschleunigen
• Die große Protein-Lüge
🎦 Dr. med. Tobias Weigl:
• Lebenselixier Proteine: Ein Proteinmangel kann fatal sein! So funktioniert das Wunderwerk Eiweiß!
• Hype um Proteine: Fake und Fakten um wahre Effekte und die richtige Proteinversorgung!
🎦 Dr. med. Ulrich Bauhofer: Pflanzliches Protein vs. tierisches Protein: Das sollten Sie wissen!
🎦 Dr. med. Ulrich Selz: Länger leben durch mehr Eiweiß – Proteinwunder!
🎦 Dr. rer. nat. Markus Stark: Die wichtigen Funktionen von Aminosäuren
🎦 Dr. med. Simon Feldhaus: Aminosäuren – Chefarzt enthüllt die unglaubliche Wahrheit
🎦 Prof. Dr. Elmar Wienecke: Aminosäuren – Mangel ist verheerend
🎦 Dr. Christian Burghart: Viele sterben an PROTEINMANGEL!
🎦 Dr. Rainer Klement: Medizinphysiker & Krebsforscher über die artgerechte Ernährung des Menschen
🎦 ZDFbesseresser: Protein Prahlerei: Sebastian entlarvt die teuren Eiweiß-Riegel
🎦 Doku Hessischer Rundfunk: Superstoff Protein
🎦 Dr. Heinz Reinwald: Die Protein-Lüge: Anabol nicht katabol
🎦 Wilfried Obel: Der Protein’ismus – der Hype mit den Proteinen
🎦 Christof Plottek: Der Einfluss der Proteine auf unsere Sinne
Kritisch bleiben: Auch wenn ein Arzt oder Wissenschaftler etwas empfiehlt oder verkauft, beweist das nicht seine Wirksamkeit. Gründliche Recherche / Rücksprache kann helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden.
FAZIT: Latenter Proteinmangel – ein unterschätztes Problem unserer Zeit! Das Thema zeigt eindrucksvoll, wie essenziell Protein für unsere Gesundheit ist – und welche überraschenden Auswirkungen ein Mangel haben kann.
Besonders betroffen sind Risikogruppen wie ältere Menschen – deren Resorptionsfähigkeit altersbedingt abnimmt – sowie Veganer / Vegetarier, mit potenziell zu geringer Proteinzufuhr.
Aber auch Mischköstler essen häufig zu kohlenhydratreich und proteinarm – ein möglicher Faktor für die Zunahme von Infekten, Virusanfälligkeit und chronischen Erkrankungen wie Krebs.
Hinzu kommt, dass viele Menschen regelmäßig auf Kantinenkost, Schnellrestaurants, Fast-Food-Ketten oder Gemeinschaftsverpflegung (z.B. in Krankenhäusern oder Betreuungseinrichtungen) angewiesen sind. Diese sind oft proteinarm, nährstoffdefizitär und qualitativ minderwertig, was eine adäquate Versorgung zusätzlich erschwert. Gerade ältere oder kranke Menschen mit geringem Appetit haben es schwer, ihren Proteinbedarf zu decken – hier braucht es gezielte Strategien und individuelle Ernährungskonzepte.
Seit 2022 lebe ich vegan. Davor war ich viele Jahre Flexiganer – und davor ganz „normaler“ Mischköstler. Über meinen Proteinbedarf habe ich mir bis dahin kaum Gedanken gemacht. Informationen zu Protein gingen an mir vorbei. Warum auch? Für mich war Protein etwas für Bodybuilder oder Kraftsportler. Als Alltagsmensch, der regelmäßig Fleisch, Wurst und Milchprodukte konsumierte, hielt ich das Thema als irrelevant. Rückblickend bin ich überzeugt, dass ich regelmäßig unter meinem täglichen Proteinbedarf lag. Besonders spannend: Bei jeder Erkältung bekam ich Heißhunger auf Fleisch – ein Phänomen, das ich mir lange nicht erklären konnte.
Im Laufe der Jahre befragte ich mehrere (Fach-)Ärzte, doch eine klare Antwort blieb aus. Heute ist mir alles klar: ein eindeutiger Fall von latentem Proteinmangel! Bei einer Infektion läuft das Immunsystem auf Hochtouren – und braucht dafür jede Menge Antikörper, die wiederum aus Proteinen bestehen.
Ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig qualifizierte Ernährungsberatung ist – denn Ernährung ist ein eigenständiges Fachgebiet, das in der medizinischen oder heilpraktischen Ausbildung oft nur am Rande behandelt wird. Nur ein ganzheitlich denkender Ernährungsberater kann solche Zusammenhänge erkennen – wie in meinem Fall: Proteinmangel als Ursache für Heißhunger auf Fleisch bei Infekten.
Hinweis: Dieser Artikel wurde von einem Ernährungsberater verfasst und dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Er ersetzt keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellt keine Therapie dar.
Medizinischer Disclaimer
Ärztlicher Hinweis: Vor eigenmächtigen Anwendungen oder Einnahmen sollte ein Arzt konsultiert werden, um Risiken sowie Neben- oder Wechselwirkungen – z. B. mit Medikamenten – auszuschließen.