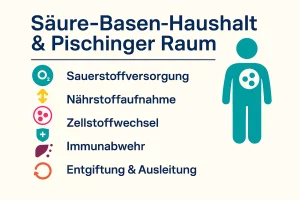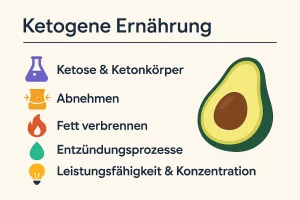Magnesium – der unterschätzte Mineralstoff, der zu den lebensnotwendigen Elektrolyten gehört und an über 600 Prozessen *1 im Körper beteiligt ist, u.a. Energie, Nerven, Muskeln, Knochen, Herz und Gehirn! Entdecke die Unterschiede zwischen tierischen, pflanzlichen und industriellen Quellen, die Vor- & Nachteile verschiedener Magnesiumformen, mögliche Folgen eines Mangels – und welchen Einfluss Magnesium bei Migräne haben kann.
- Magnesium im Körper
- Magnesium in der Ernährung
- Formen & Unterschiede
- Natürliche vs. industrielle Quellen
- Magnesiumverbindung vs. elementares Magnesium (Achtung bei Verpackungsangaben!)
- Magnesiumformen (Unterschiede)
- Organisch vs. anorganisch
- Aufnahme & Darreichung
- Resorption & Einflussfaktoren (wie viel kommt im Körper an)
- Blut-Hirn-Schranke (BHS)
- Darreichungsform (Tablette, Pulver, Brause, liposomales Magnesium)
- Multi-Formeln (Vorteile)
- Anwendung & Diagnostik
- Präparate (bei Migräne / als NEM)
- Der „Magnesium-Hype“
- Diagnostik (Symptome, Laborwerte, Tests, Grenzen)
- Häufige Einsatzbereiche
- Mythencheck
- DOKU-Tipps / Fazit / Ärztlicher Hinweis
- Legende: NEM = Nahrungsergänzungsmittel / i.v. = intravenös / Mg = Magnesium
GRATIS Download des ganzen Artikels (PDF 15 Seiten)
- Energieproduktion – Aktivierung von ATP, der Hauptenergiequelle jeder Zelle.
- Nerven & Muskeln – reguliert die Reizweiterleitung, schützt vor Übererregung, fördert Muskelentspannung und beugt Krämpfen vor.
- Herz-Kreislauf – unterstützt stabilen Herzrhythmus, gesunde Gefäßfunktion, wirkt gefäßerweiternd, reguliert den Blutdruck. An der Blutgerinnung beteiligt.
- Knochen & Zähne – rund 50 % des Magnesiums sind im Knochen; wichtig für Stabilität, Mineralisierung.
- Gehirn & Psyche – beteiligt an Signalübertragung, Gedächtnisprozessen, Stressregulation; unterstützt den Schlaf durch Einfluss auf Neurotransmitter wie GABA.
- Stoffwechsel – essenziell für Blutzuckerregulation, Fettstoffwechsel, Proteinsynthese.
- Protein-, DNA- & RNA-Synthese – essenziell für Zellteilung, Neubildung von Erbmaterial, Bildung von Glutathion (wichtiges Antioxidans).
- Immunsystem & Entzündungsmodulation – stärkt Immunzellen, reguliert Entzündungsprozesse.
- Elektrolythaushalt – steuert das Gleichgewicht von Kalzium, Kalium und Natrium; wichtig für Flüssigkeits- und Reizleitungsgleichgewicht.
- Hormonregulation – unterstützt die Aktivierung von Vitamin D und beeinflusst Stresshormone.
- Entgiftung & Leberfunktion – Cofaktor bei Enzymen in der Leber, wichtig für Abbau/Entgiftung von Stoffwechselprodukten.
Halbwertszeit & Speicher
- Nach oraler Einnahme
- Blutspiegel: steigt leicht und kurzfristig.
- Überschuss: Nieren scheiden schnell aus (bei hoher Dosis auch der Darm → Durchfall).
- Keine schnelle Einlagerung: Knochen/Muskeln sind träge Speicher
- Knochen: ein Teil ist schnell austauschbar (Tage–Wochen), der Rest nur über langsamen Knochenumbau (Jahre).
- Muskeln: nehmen Magnesium nur begrenzt und langsam auf.
- Schutzmechanismus: Überschüsse werden bevorzugt ausgeschieden, um Störungen in Zellen zu vermeiden.
- Halbwertszeit im Blut ca. 24 Stunden.
- Blutspiegel ungeeignet als Gesamtmarker, da <1 % des Körpermagnesiums im Blut liegt.
- Speicherorte (Gesamtbestand ca. 24–30 g)
- ~50 % Knochen (davon ~⅓ schnell verfügbar als Puffer)
- ~30 % Muskeln
- ~20 % Organe/Gewebe (z.B. Herz, Nerven, Leber)
- <1 % Blut/Extrazellulärraum (kein Speicher)
- Speicherdauer
- Knochen: langsam – Wochen bis Monate (strukturell Jahre).
- Muskeln/Weichgewebe: mittlerer Umsatz – Tage bis wenige Wochen.
- Blut: sehr schneller Austausch – <1 Tag.
Speicherverlust & Folgen
- Verlust in Knochen/Gewebe
- Knochen: Puffern Magnesium, doch chronische Abgabe schwächt langfristig die Knochenqualität (z.B. Osteoporose-Risiko).
- Muskeln & Organe: Ein Abfall führt zu neuromuskulärer Übererregbarkeit (Krämpfe, Zuckungen, Herzrhythmusstörungen).
- Blutwerte bleiben normal, solange Speicher kompensieren – dennoch kann ein funktioneller Mangel vorliegen.
- Wann erste Probleme entstehen können
- Der Körper kompensiert Verluste unterschiedlich gut – je nach Genetik, Ernährung, Nierenfunktion oder Medikamenten.
- 10–15 % Verlust: kann schon erste unspezifische Beschwerden auslösen.
- 20–30 % Verlust: führt meist zu deutlichen Symptomen wie Muskelkrämpfen, Herzrhythmusstörungen oder neurologischen Beschwerden.
-
30–40 % Verlust: tritt selten auf, meist bei starker Unterversorgung, Alkoholmissbrauch, Darmerkrankungen oder bestimmten Medikamenten.
Magnesiumverbrauch & -verlust im Körper
- Innere Faktoren (körperinterne Prozesse)
- Stressreaktionen: Bei körperlichem/psychischem Stress werden Stresshormone (z. B. Adrenalin, Cortisol) ausgeschüttet → Mg-Verbrauch steigt
- Stoffwechselaktivität: Beschleunigter Stoffwechsel (z. B. bei Schilddrüsenüberfunktion, Fieber, Wachstum) → Mg-Verbrauch steigt
- Krankheiten:
- Diabetes mellitus (verstärkte Ausscheidung über die Nieren bei hoher Blutzuckerausscheidung)
- Nieren-/Durchfallerkrankungen (vermehrter Verlust)
- Chronische Entzündungen
- Hormonelle Faktoren:
- Schwangerschaft/Stillzeit (Mg-Verbrauch steigt durch Versorgung des Kindes)
- Menstruation (leichte Verluste, zusätzliche Belastung)
- Alter: Mit zunehmendem Alter nimmt die Mg-Aufnahme im Darm ab, während der Bedarf steigt
- Genetische Faktoren: Die Fähigkeit, Magnesium im Darm aufzunehmen und in den Zellen zu speichern, variiert individuell
- Äußere Faktoren (Lebensstil und Umwelt)
- Körperliche Aktivität: Sport/Muskelarbeit → Mg-Verbrauch steigt (für Muskelkontraktion, Energiegewinnung, Regeneration)
- Ernährung:
- Zucker, Weißmehlprodukte, Fertignahrung → magnesiumarm
- Hohe Eiweiß-/Fettzufuhr → Mg-Verbrauch steigt
- Alkohol, Kaffee, koffeinhaltige Getränke → fördern die Ausscheidung über die Nieren
- Medikamente:
- Diuretika („Wassertabletten“)
- Abführmittel (Laxantien)
- Protonenpumpenhemmer (Magenschutzmittel, beeinträchtigen die Aufnahme)
- Umwelt-/Lebensstilfaktoren:
- Chronischer Stress (körperlich/psychisch)
- Rauchen
- Hitze (Schwitzen → Mineralstoffverluste)
Zufuhrempfehlungen
Die DGE-Referenzwerte (z.B. 350 mg/Tag Magnesium) beziehen sich auf
- Elementares Magnesium, nicht auf Mg-Verbindungen.
- Zufuhrmengen (Nahrung/Supplemente), also auf das, was du zuführst.
- Die DGE arbeitet mit Zufuhrmengen, weil die individuelle Resorption stark schwankt (abhängig von Alter, Verbindung, Dosis, Mahlzeit, Darmgesundheit, etc.).
- Bei normaler Ernährung werden je nach Verbindung und individuellen Faktoren (bei Oxid bis 15 %, bei Citrat/Glycinat bis 40 %) des zugeführten Magnesiums tatsächlich resorbiert.
- Deshalb liegt die „empfohlene Zufuhr“ höher als der eigentliche physiologische Bedarf.
- Bei Zufuhr von 350 mg elementarem Magnesium, kommen nur etwa 120–175 mg im Körper an.
Magnesiumquellen
- Fisch (z.B. Lachs, Makrele, Heilbutt)
- Form: Mg-Phosphate, Protein-Komplexe
- Bioverfügbarkeit: gut, keine Hemmstoffe wie Phytat/Oxalat
- Milch/Käse
- Form: Mg-Phosphate (gebunden an Casein)
- Bioverfügbarkeit: mittel, keine Phytate/Oxalate. Calcium kann die Aufnahme bremsen
- Fleisch (Rind, Schwein, Geflügel)
- Form: Mg-Phosphate, Protein-Komplexe
- Bioverfügbarkeit: gut, keine Hemmstoffe wie Phytat/Oxalat
- Eier
- Form: Mg-Phosphate (v.a. im Eigelb)
- Bioverfügbarkeit: mittel, keine Hemmstoffe wie Phytat/Oxalat
- Meeresfrüchte (z.B. Garnelen, Muscheln)
- Form: Mg-Salze (Phosphate, Chloride, Sulfate)
- Bioverfügbarkeit: gut, keine Hemmstoffe wie Phytat/Oxalat
- Grünes Blattgemüse (z.B. Spinat, Mangold, Grünkohl)
- Form: Magnesium im Chlorophyll-Komplex, Citrat, Malat
- Bioverfügbarkeit: mittel, durch Oxalsäure teilweise gehemmt
- Hülsenfrüchte (z. B. Linsen, Bohnen, Kichererbsen)
- Form: Mg-Phytat, Citrat, Malat
- Bioverfügbarkeit: niedrig bis mittel, deutlich durch Phytat gehemmt
- Nüsse/Samen (z.B. Kürbiskerne, Mandeln, Cashews)
- Form: Mg-Phytat und organische Salze
- Bioverfügbarkeit: niedrig bis mittel, deutlich durch Phytat gehemmt
- Vollkornprodukte (z.B. Haferflocken, Vollkornbrot, Quinoa)
- Form: überwiegend Mg-Phytat
- Bioverfügbarkeit: niedrig, deutlich durch Phytat gehemmt; verbessert durch Keimen / Sauerteig
- Bananen/Avocados
- Form: Organische Mg-Salze (Citrat, Malat)
- Bioverfügbarkeit: gut, kaum Hemmstoffe wie Phytat/Oxalat
- Bioverfügbarkeit
- Tierische Nahrungsmittel enthalten weniger Magnesium, aber wird meist besser aufgenommen, da kaum Hemmstoffe (Phytat, Oxalat) vorkommen.
- Pflanzliche Nahrungsmittel haben oft höhere Magnesiumgehalte, aber die Aufnahme kann durch Phytat /Oxalat eingeschränkt sein.
- Verbesserung der Aufnahme: Einweichen, Keimen, Fermentieren (z.B. Sauerteigbrot) baut Phytat ab → Bioverfügbarkeit steigt.
Nährstoffschwund in Nahrungsmitteln
Untersuchungen dokumentieren einen deutlichen Rückgang des Magnesiumgehalts (und weiterer Mineralstoffe) in natürlichen Nahrungsmitteln über die letzten Jahrzehnte.
Glyphosat kann Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Mangan und Eisen binden und so ihre Verfügbarkeit in Boden und Pflanzen verringern. Da unser Körper Mineralstoffe vor allem in freier oder leicht löslicher Form aufnimmt, ist Magnesium, das an Glyphosat gebunden ist, für uns kaum nutzbar – wenn überhaupt.
|
Nahrungsmittelgruppe |
Zeitraum |
Rückgang Magnesium (%) |
|
Obst |
ca. 50 Jahre |
7–25 % |
|
Gemüse allg. |
ca. 50 Jahre |
15–35 % |
|
Gemüsesorten wie Kohl, |
1914–2018 |
80–90 % |
|
Fleisch & Milchprodukte |
über Jahrzehnte |
Rind: 4–8 % Huhn: 4 % |
|
Weizen |
seit 1960er Jahren |
20 % |
Verluste bei Lagerung, Verarbeitung, Zubereitung
Magnesium ist hitzestabil, aber wasserlöslich. Deshalb gehen bei Lagerung, Verarbeitung, Zubereitung häufig relevante Mengen verloren.
Entscheidend ist also nicht nur, wie viel Magnesium in Lebensmitteln steckt, sondern auch, wie viel am Ende tatsächlich auf dem Teller ankommt.
- Industrielle Verarbeitung
- Ausmahlen: Beim Weißmehl geht ein großer Teil des Magnesiums verloren, weil es vor allem in der Schale/Kleie steckt.
- Raffinieren von Zucker oder Ölen: Entfernt nahezu alle Mineralstoffe, auch Magnesium.
- Konservierung, Schälen, Polieren: Polierter Reis hat deutlich weniger Magnesium als Naturreis.
- Lagerung & industrielle Konserven: Mineralstoffverluste durch Auslaugung ins Wasser (z.B. Gemüse in Dosen).
- Häusliche Zubereitung
- Kochen: Mineralstoffe gehen mit dem Kochwasser verloren.
- Einweichen von Gemüse/Obst: Langes Wässern zieht Mineralstoffe heraus.
- Schälen: Entfernt magnesiumreiche Randschichten (z.B. bei Kartoffeln, Äpfeln).
- Reis-/Nudelwasser abgießen: Spült wasserlösliche Mineralstoffe weg.
- Braten/Backen: Mineralstoffverluste durch austretende Flüssigkeit.
- Tipp: Dämpfen, Dünsten, Kochwasser weiter verwenden und Vollkorn statt Weißmehl.
Wechselwirkungen mit anderen Nährstoffen
- Calcium: Magnesium + Calcium wirken eng zusammen bei Muskelkontraktion/-entspannung. Ein Ungleichgewicht (z.B. zu viel Calcium, zu wenig Magnesium) kann Krämpfe oder Herzrhythmusstörungen begünstigen.
- Kalium: Magnesium unterstützt die Funktion von Kaliumkanälen in den Zellen. Ein Mg-Mangel kann deshalb auch zu einem sekundären Kaliummangel führen (häufig bei Herzrhythmusstörungen relevant).
- Vitamin D: fördert die Aufnahme von Magnesium im Darm, gleichzeitig ist Magnesium nötig für die Aktivierung von Vitamin D in Leber/Niere. Ohne ausreichend Magnesium kann Vitamin D seine Wirkung nur eingeschränkt entfalten.
- Vitamin B6: Unterstützt die zelluläre Aufnahme von Magnesium und kann die Wirkung bestimmter Magnesiumpräparate verbessern (z. B. bei Nervosität oder PMS).
- Natrium: Steht mit Magnesium (und Kalium) im Gleichgewicht des Elektrolythaushalts. Hoher Salzkonsum kann Mg-Verluste über die Niere fördern.
- Phosphat: Hohe Phosphatzufuhr (z.B. durch Fertigprodukte, Cola) kann die Mg-Aufnahme hemmen.
- Ballaststoffe / Phytinsäure: Hohe Mengen Phytinsäure können die Mg-Resorption beeinträchtigen.
- Eiweiß: Zu wenig Eiweiß kann die Mg-Bindung im Körper schwächen, ausreichend Eiweiß fördert die Verwertung.
- Alkohol – kein Nährstoff, aber wichtig: Alkohol erhöht die Ausscheidung von Magnesium und kann Defizite verstärken.
Natürliche vs. industrielle Quellen
- Magnesium aus natürlichen Nahrungsmittel
- Form: In tierischen Quellen meist als Mg-Phosphate oder Protein-Komplexe, in pflanzlichen als Magnesium im Chlorophyll, Phytat-Komplexe, Citrat oder Malat.
- Bioverfügbarkeit:
- Tierische Quellen: mittel bis gut, da kaum Hemmstoffe wie Phytat/Oxalat.
- Pflanzliche Quellen: oft eingeschränkt, weil Phytat (in Hülsenfrüchten, Vollkorn, Nüssen) und Oxalat (z.B. in Spinat) Magnesium binden und die Aufnahme mindern kann.
- Durchschnittliche Aufnahme aus Nahrungsmitteln: 30–50 % des enthaltenen Magnesiums.
- Besonderheit: Nahrungsmittel enthalten neben Magnesium weitere Nährstoffe (Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamine), die positiv / negativ auf die Aufnahme wirken können → komplexes Zusammenspiel.
- Vorteil: ganzheitliche Versorgung (weitere Mineralstoffe, Vitamine).
- Nachteil: Hemmstoffe wie Phytat/Oxalat mindern die Aufnahme → effektiv 30–50 %.
- Magnesium industriell hergestellt
- Form: Klare chemische Salze wie Mg-Oxid, -citrat, -glycinat usw.
- Bioverfügbarkeit: hängt stark von Salzform ab:
- Organisch (Citrat, Glycinat, Malat, Laktat): höhere Aufnahme, ca. 30–40 %.
- Anorganisch (Oxid, Carbonat): geringere Aufnahme, ca. 5–15 %, aber hoher Mg-Gehalt.
- Besonderheit: Aufnahme ist unabhängiger von Nahrungsbestandteilen.
- Vorteil: definierte Dosis, gezielte Salzform, bessere Steuerung.
- Nachteil: einseitige Aufnahme, Gefahr von Überdosierung, keine zusätzlichen Nährstoffe.
- Sinnvoll bei erhöhtem Bedarf (z.B. Migräneprophylaxe, Schwangerschaft, Mangelzustände) oder einseitiger Ernährung.
Magnesiumverbindung vs. elementares Magnesium
- Magnesium
- In NEM kommt Magnesium immer in einer chemischen Verbindung vor – z.B. Mg-Citrat, -oxid.
- Die Verpackungsangabe („400 mg Magnesiumcitrat“) bezieht sich auf die gesamte Menge, nicht nur auf den Mg-Anteil.
- Diese Verbindungen bestehen aus Magnesium + Säure / Anion, z.B.
- Mg-Oxid → Magnesium + Sauerstoff
- Mg-Citrat → Magnesium + Zitronensäure
- Elementares Magnesium
- Ist der tatsächliche Magnesium-Anteil in einer Verbindung, den der Körper als Mineralstoff aufnehmen kann.
- Jede Verbindung enthält unterschiedlich viel elementares Magnesium:
- Mg-Oxid: ca. 60 % Magnesium
- Mg-Citrat: ca. 16 % Magnesium
- Mg-Glycinat: ca. 14 % Magnesium
- Mg-Sulfat: ca. 10 % Magnesium
- Deshalb kann „400 mg Mg-Citrat“ nur ca. 64 mg elementares Magnesium liefern.
- „400 mg Mg-Oxid“ liefert ca. 240 mg elementares Magnesium – wird aber schlechter aufgenommen.
Magnesiumformen (Unterschiede)
Es gibt viele verschiedene Mg-Formen (Mg-Salze), die sich vor allem in Form, Löslichkeit, Darmaufnahme und Verträglichkeit unterscheiden. Nach der Aufnahme liegt immer freies Mg²⁺ vor – die Salzform beeinflusst also nicht die Wirkung im Körper, sondern wie gut und wie schnell es aufgenommen wird. Die Vielfalt existiert, weil sich Bioverfügbarkeit, Verträglichkeit und Anwendung unterscheiden – und weil es einen Markt für „spezialisierte“ Formen gibt.
- Chemie: Magnesium bildet mit vielen Säuren oder Substanzen Salze (z.B. Citrat, Laktat, Glycinat). Jede Verbindung hat verschiedene Vor-/Nachteile.
- Bioverfügbarkeit: Ist die Löslichkeit im Magen/Darm besser → bessere Aufnahme, ist die Löslichkeit schlechter → mehr Durchfall.
- Verträglichkeit: Je nach Bindung sind Präparate magenfreundlicher oder stärker abführend.
- Anwendung: Medizinisch (z.B. Sulfat), NEM (Citrat, Glycinat), Brause (Carbonat), Sport (Aspartat, Malat).
- Marketing: Hersteller betonen „Zusatznutzen“ (Herz = Orotat, Energie = Malat, Gehirn = L-Threonat).
In dieser Übersicht sind die wichtigsten Magnesiumformen aufgeführt, die in NEM und der medizinischen Anwendung eine Rolle spielen. Es existieren zahlreiche weitere Formen.
Legende: Mg = Magnesium / Organisch / Anorganisch / (Mg-Verbindung) / Löslichkeit / AS = Aminosäure
|
Eigenschaften / Aufnahme |
Einsatzgebiete (inkl. Migräne) |
Einsatzzweck |
|
|
Magnesiumoxid |
Niedrige Aufnahme, hoher Mg-Anteil, oft abführend |
Migräneprophylaxe, allg. Ergänzung bei Mangel, hochdosiert als Abführmittel |
Standard in Migränestudien, viel Magnesium pro Gramm, preiswert |
|
Magnesiumcitrat |
Gute Aufnahme, mild abführend, meist verträglich |
Migräneprophylaxe, allg. Ergänzung, Unterstützung bei leichter Verstopfung |
Sehr gute Bioverfügbarkeit, breit verfügbar, zusätzlich verdauungsfördernd |
|
Magnesiumglycinat |
Gute Aufnahme, sehr gut verträglich, kaum abführend |
Migräneprophylaxe (bei empfindlichem Magen/Darm), Langzeiteinnahme zur allgemeinen Ergänzung |
Sehr magenfreundlich, langfristig gut verträglich |
|
Magnesiumlaktat |
Mittel bis gute Aufnahme, gut verträglich |
Allg. Nahrungsergänzung, oft in Kombipräparaten |
Solide Aufnahme, oft in NEM |
|
Magnesiumchlorid |
Kann Magen reizen, äußerlich hautreizend |
Medizinische Infusionen bei akutem Mangel, äußerlich als „Magnesiumöl“ |
Rasche Aufnahme i.v., für Migräne nur klinisch i.v. |
|
Magnesiumsulfat |
Stark abführend |
Medizinisch als Darmreinigung; Klinisch i.v. bei Präeklampsie und akuten Migräneattacken |
Klinisch bewährt in Notfällen, oral vor allem als Abführmittel („Bittersalz“) |
|
Magnesiumaspartat |
Gute Aufnahme, teils abführend |
Ergänzung in Sport- / Energiepräparaten |
Aspartat ist Teil des Energiestoffwechsels, daher v.a. im Sportbereich |
|
Magnesiummalat |
Gute Aufnahme, gut verträglich |
Einsatz bei Müdigkeit / Muskelschmerzen (z.B. Fibromyalgie) |
Malat spielt eine Rolle im Citratzyklus, beworben für Energieproduktion |
|
Magnesiumorotat |
Gute Aufnahme, gut verträglich |
In Präparaten für Herz-Kreislauf-Patienten |
Orotat soll Herzenergie-versorgung verbessern, v.a. kardiologischer Einsatz |
|
Magnesiumtaurat |
Meist verträglich |
Spezialpräparate für Herz / Nervensystem |
Kombination mit Taurin, soll beruhigend / herzschützend wirken |
|
Magnesium-L-threonat |
Experimentell, Tierdaten: evtl. besser ins Gehirn |
Nahrungsergänzung für kognitive Unterstützung (Gedächtnis, Konzentration) |
Beworben für Gehirnleistung, wissenschaftlich unsicher |
|
Magnesiumcarbonat |
Mäßige Aufnahme, kann Blähungen/Durchfall verursachen |
Häufig in Brausetabletten (sprudelt), eingesetzt auch als Antazidum (Sodbrennen) |
Praktisch als Brauseform, neutralisiert Magensäure |
Gut wasserlöslich: Citrat, Glycinat, Laktat, Chlorid, Sulfat, Aspartat, Malat, L-Threonat.
Mäßig wasserlöslich: Orotat, Taurat.
Sehr schlecht wasserlöslich: Oxid, Carbonat (erst im Magen mit Säure reagierend).
Organisch vs. Anorganisch
Organisch: Alles, was auf eine bekannte organische Säure verweist (Zitronensäure, Milchsäure, Aminosäure, etc.)
Anorganisch: Alles, was von Oxiden, Sulfaten, Chloriden, Carbonaten kommt.
Hochwertige Magnesiumpräparate enthalten organische Formen (Citrat, Glycinat, Malat, Taurat, Threonat), Aufnahme ca. 30–40 %.
Anorganische Magnesiumverbindungen sind in der Regel günstiger, aber oft mit geringerer Aufnahme und teilweise stärker abführend.
Günstige Produkte enthalten oft Oxid, Carbonat – viel Magnesium pro Tablette, aber wenig Aufnahme, ca. 5–15 %.
Beispielrechnung: Die % Angabe beziehen sich auf die Resorption des elementaren Magnesiums.
- Mg-Oxid
- enthält ca. 60 % elementares Magnesium, aber nur 5–15 % werden resorbiert.
- 400 mg Magnesiumoxid = ca. 240 mg elementares Magnesium. Effektive Aufnahme ca. 20–35 mg.
- Mg-Citrat
- enthält nur ca. 16 % elementares Magnesium, aber 30–40 % werden resorbiert.
- 400 mg Magnesiumcitrat = ca. 64 mg elementares Magnesium. Effektive Aufnahme ca. 20–25 mg.
Obwohl Oxid viel mehr Magnesium pro Gramm enthält, geht der größte Teil durch den Darm „verloren“ (wird nicht aufgenommen oder wirkt abführend).
Citrat oder Glycinat haben weniger Rohgehalt, aber der Körper nutzt sie effizienter.
Resorption & Einflussfaktoren
- Aufnahmewege im Darm
- Aktiver Transport: energieabhängig, begrenzt, ab bestimmter Menge gesättigt.
- Passiver Transport: durch die Zellzwischenräume zwischen den Darmzellen.
→ Bei zu hoher Dosis werden Transportwege „überfüllt“, der Rest wird ausgeschieden (Sättigungseffekt).
- Löslichkeit der Verbindung
- Organische Salze → gut wasserlöslich → bessere Aufnahme.
- Anorganische Salze → schlecht wasserlöslich → große Mengen bleiben ungenutzt im Darm.
- Dosis & Zeitpunkt
- Kleine Dosen (2–3× täglich) sind besser resorbierbar als große Einzeldosen.
- Hohe Dosen (>300 mg): verringerte relative Aufnahme, häufiger Durchfall.
- Uhrzeit: Morgens / abends möglich; abends vorteilhaft (entspannende Wirkung, Schlafunterstützung).
- Fördernde Faktoren
- Mit einer Mahlzeit: Magensäure fördert die Löslichkeit.
- Vitamin D: steigert Transportproteinbildung.
- Vitamin B6: verbessert Aufnahme und Verwertung in Zellen.
- Eiweiß/Aminosäuren: fördern Aufnahme.
- Organische Säuren (Citrat, Malat, Ascorbat) unterstützen die Resorption.
- Hemmende Faktoren
- Sehr hohe Calcium-Mengen >500 mg (Konkurrenz um Transportwege).
- Ballaststoffe/Phytate (Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse) und Oxalate (Spinat, Rhabarber) binden Magnesium.
- Hohe Fettmengen, Alkohol, Kaffee, Schwarztee senken Aufnahme / fördern Ausscheidung.
- Protonenpumpenhemmer (Magenschutzmittel) senken Magensäure → schlechte Aufnahme, v.a. Oxid.
- Darmerkrankungen (z.B. Morbus Crohn, Zöliakie, Durchfälle) verschlechtern die Resorption.
- Darmtoleranz
- Nicht aufgenommenes Magnesium wirkt osmotisch (zieht Wasser in den Darm) → weicher Stuhl bis Durchfall.
- Besonders bei schlecht löslichen Formen (Magnesiumoxid, -sulfat).
- Fazit: Die Aufnahme von Magnesium ist begrenzt, weil:
- Transportkanäle im Darm gesättigt werden
- Löslichkeit der Verbindung unterschiedlich ist
- Große Einzeldosen weniger effizient aufgenommen werden
- Andere Stoffe konkurrieren / binden
- Darmtoleranz überschüssiges Magnesium ausscheidet
Blut-Hirn-Schranke (BHS)
- Das Gehirn braucht Magnesium unbedingt für seine Funktion.
- Die BHS lässt Magnesium als freies Mg²⁺-Ion hindurch, gesteuert über Transporter/Ionenkanäle.
- Alle Mg-Formen werden im Darm zerlegt, gelangen als freies Mg²⁺ ins Blut und nur so transportiert.
- Unterschiede zwischen Präparaten betreffen Darmaufnahme & Nebenwirkungen, nicht die „magische“ Fähigkeit, die BHS zu überwinden.
- Organische Salze wie Citrat/Laktat sind besser bioverfügbar als Oxid/Sulfat.
Darreichungsform
Die meisten Magnesiumformen sind frei im Handel als NEM / Arzneimittel erhältlich. Unterschiede gibt es vor allem bei Darreichungsform / Anwendung.
- Frei im Handel (Apotheke, Drogerie, Online, Supermarkt)
- Mg-Oxid → Kapseln, Tabletten; sehr häufig in „Magnesium 400 mg“-Präparaten.
- Mg-Citrat → Pulver (häufig zum Auflösen in Wasser), Kapseln, Brausetabletten.
- Mg-Glycinat (Bisglycinat) → Kapseln, Tabletten; eher in hochwertigen / speziellen NEM.
- Mg-Carbonat → Brausetabletten (sprudelt), Pulver; oft in Kombipräparaten.
- Mg-Laktat, -aspartat, -malat, -orotat, -taurat → Kapseln, Tabletten, NEM.
- Mg-Chlorid → als „Magnesiumöl“ (Hautanwendung) oder Pulver zum Auflösen in Wasser.
- Mg-Sulfat (Bittersalz) → Abführmittel oder Badezusatz.
- Mg-L-threonat → als Kapseln/Tabletten in NEM, meist nur online oder in spezialisierten Shops.
- Nur ärztlich / klinisch als Infusion
- Mg-Sulfat i.v. → bei Eklampsie oder akuten Migräneattacken.
- Mg-Chlorid i.v. → zur schnellen Magnesiumgabe bei schwerem Mangel.
Speziell – Liposomales Magnesium: Dazu wird Magnesium in winzige Fettbläschen („Liposomen“) eingebettet wird. Diese Liposomen bestehen meist aus Phospholipiden (z.B. Lecithin), die auch Bestandteil unserer Zellmembranen sind.
- „Mögliche“ Vorteile
- Bessere Bioverfügbarkeit: Liposomen können die Aufnahme im Darm erleichtern und das Magnesium „geschützt“ in den Blutkreislauf bringen.
- Schonend für Magen-Darm-Trakt: Manche Magnesiumformen (z. B. Magnesiumoxid) können abführend wirken. Liposomales Magnesium gilt als verträglicher.
- Gezieltere Aufnahme: Da die Liposomen die Zellmembranen leicht passieren können, könnte das Magnesium effizienter in die Zellen gelangen.
- ABER
- Studienlage: Liposomale Präparate können „vielleicht“ die Aufnahme verbessern, aber die wissenschaftliche Datenlage ist noch unklar.
- Dosierung: Meist reichen 200–400 mg elementares Magnesium pro Tag (abhängig vom Bedarf). Liposomale Produkte enthalten oft geringere Mengen, sind aber vielleicht effizienter in der Aufnahme.
- Preis: Liposomale Produkte sind meist teurer als herkömmliche Magnesiumpräparate.
Multi-Formeln (Vorteile)
- Verschiedene Resorptionswege
- Unterschiedliche Magnesiumsalze nutzen verschiedene Transportmechanismen im Darm.
- Durch die Mischung erhöht man die Chance, dass auch bei individueller Schwäche (z. B. wenig Magensäure, empfindlicher Darm) ein Teil optimal aufgenommen wird.
- Ergebnis: bessere Gesamt-Bioverfügbarkeit.
- Schnelle & langsame Freisetzung
- Citrat, Ascorbat, Gluconat → schnelle Aufnahme → schneller Anstieg des Blutspiegels.
- Bisglycinat, Malat → gleichmäßige, längere Freisetzung → stabilere Spiegel.
- Oxid → langsame, minimale Aufnahme, dafür hoher Gehalt → kann längerfristig kleine Mengen liefern.
- Ergebnis: Ein „Sofort- & Depot-Effekt“.
- Verschiedene Verdauungstypen
- Citrat kann abführend wirken → wird durch Gluconat & Bisglycinat abgepuffert.
- Oxid kann säurebindend sein → günstig für Menschen mit Sodbrennen.
- Mischung reduziert das Risiko, dass eine einzelne Form Magen/Darm zu stark reizt.
- Marketing & Differenzierung
- „Multi-Formel“ klingt hochwertiger.
- „Wenn mehrere Formen drin sind, bekommt man die Vorteile von allen.“
- Verkaufsargument, auch wenn meist 1–2 Formen genügen würden.
- Unterschiedlicher Schwerpunkte, z.B.
- Oxid → günstiger Rohstoff, hoher Mg-Anteil, Kostenersparnis im Mischprodukt.
- Citrat, Malat → Energie, Muskelstoffwechsel.
- Bisglycinat → Nervensystem, Schlaf, Stress.
- Ascorbat → schnelle Aufnahme.
- Gluconat → gute Basisversorgung.
Präparate
- Bei Migräne
- Mg-Oxid: In Untersuchungen am häufigsten verwendet (400–600 mg elementares Magnesium/Tag).
- Vorteil: standardisierte Datenlage.
- Nachteil: geringe Aufnahme, häufiger Durchfall oder Blähungen.
- Mg-Oxid: In Untersuchungen am häufigsten verwendet (400–600 mg elementares Magnesium/Tag).
- Alternativen bei Migräne & empfindlichem Magen-Darm-Trakt
- Mg-Citrat: Gute Aufnahme.
- Vorteil: oft besser verträglich als Oxid, zusätzlich leicht abführend (hilfreich bei Verstopfung).
- Nachteil: etwas weniger elementares Magnesium/Gramm → höhere Mengen nötig.
- Mg-Glycinat (Bisglycinat): Sehr gute Verträglichkeit, kaum abführend.
- Vorteil: geeignet bei empfindlichem Darm oder bei Langzeiteinnahme.
- Nachteil: meist teurer, weniger in Migränestudien untersucht.
- Mg-Citrat: Gute Aufnahme.
- Als NEM (ohne Migräne)
- Mg-Citrat: Gute Aufnahme, ideal für Alltag. Vorteil: weit verbreitet, günstig, gut untersucht.
- Mg-Glycinat: Sehr verträglich, kein Durchfall. Vorteil: geeignet für empfindliche Verdauung oder Langzeiteinnahme. Etwas teurer.
- Mg-Laktat: Gut verträglich, solide Aufnahme. Vorteil: häufig in Kombipräparaten, für normale Ergänzung ausreichend.
- Mg-Carbonat: In Brausetabletten beliebt, neutralisiert zusätzlich Magensäure.
- Nicht optimal für Dauerergänzung
- Mg-Oxid (wenig Aufnahme, oft Durchfall).
- Mg-Sulfat (stark abführend, nur gezielt sinnvoll).
- Exotische Formen (Orotat, Taurat, L-Threonat) – teuer, Nutzen unklar.
Der „Magnesium-Hype“
- Der Hype kommt aus einer Mischung von
- Medizinischer Bedeutung
- Lifestyle-Trends/gezieltem Marketing
- Unterversorgung durch Ernährung, Fastfood
- und dem Wunsch vieler Menschen nach einer einfachen Lösung für komplexe Probleme wie Stress, Müdigkeit oder Migräne.
- Relevanz
- Magnesium ist an über 300 Enzymreaktionen beteiligt (Energie, Nerven, Muskeln, Knochen, Herz und Gehirn).
- Ein Mangel kann u.a. Muskelkrämpfe, Herzrhythmusstörungen, Nervosität, Kopfschmerzen auslösen.
- Die Aufnahme über die Ernährung ist in Industrienationen oft gerade so ausreichend, weil verarbeitete Nahrungsmittel / Weißmehlprodukte weniger Magnesium enthalten als Vollkorn, Hülsenfrüchte oder Nüsse.
- Gesundheitstrends & Lifestyle
- In den 1980er/1990er Jahren wurde Magnesium populär als „Krampf-Mineral“ (Wadenkrämpfe, Herzschutz).
- Heute wird es in Lifestyle- & Fitness-Szenen beworben: Stressmanagement, Muskelregeneration, Schlafqualität, Migräneprävention, Energie.
- Magnesium wird oft mit „modernen Mangelerscheinungen“ in Verbindung gebracht (Stress, Fast Food, Umweltbelastungen), was eine starke Nachfrage erzeugt.
- Marketing & Industrie
- NEM-Hersteller bewerben Magnesium als „Multitalent“: für Nerven, Muskeln, Psyche, Herz, Knochen, Sport, Schwangerschaft.
- Unterschiedliche Magnesiumformen (Citrat, Glycinat, Threonat …) werden mit speziellen Effekten vermarktet (Datenlage unklar).
- Wissenschaft vs. überhöhte Darstellung
- Untersuchungen zeigen: Magnesium kann bei Migräneprophylaxe, Präeklampsie, Herzrhythmusstörungen und Muskelkrämpfen helfen.
- Für andere Bereiche (z.B. Schlaf, Stress, Gedächtnis, Sportleistung) ist die Datenlage uneinheitlich.
Diagnostik
- Symptome eines Magnesiummangels: Die meisten treten subtil auf und werden oft nicht als Mangel erkannt.
- Unspezifisch: Müdigkeit, Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme, Nervosität und Schlafstörungen. sind nicht eindeutig auf Magnesiummangel zurückzuführen.
- Spezifisch: Muskelkrämpfe (vor allem in Waden, Füßen), Muskelzuckungen, Herzrhythmusstörungen, erhöhte neuromuskuläre Erregbarkeit (z.B. Zittern), Kopfschmerzen oder Migräne.
- Langfristig/chronisch: Osteoporose-Risiko, Bluthochdruck, Störungen im Glukosestoffwechsel.
- Laborwerte: Serumwerte sind oft trügerisch. Vollblut oder intrazellulär geben ein realistischeres Bild.
- Serum: Standardtest, aber wenig aussagekräftig, da nur ~1 % des Magnesiums im Blut zirkuliert. Trotz Normwerte kann ein Mangel vorliegen.
- Vollblut: Misst Serum + Magnesium in Blutzellen (v.a. Erythrozyten), daher etwas aussagekräftiger.
- Intrazellulär: Misst in stoffwechselaktiven Zellen (z.B. Lymphozyten, Muskelzellen), die den Gesamtstatus besser widerspiegeln als Erythrozyten.
- Funktionstests / Belastungstests: Eher in Spezialdiagnostik / Forschung üblich, selten eingesetzt.
- Magnesium-Belastungstest: Magnesium wird verabreicht und anschließend gemessen, wie viel über den Urin ausgeschieden wird. Niedrige Ausscheidung deutet auf einen Mangel hin.
- Klinische Funktionstests: Beobachtung von Krampfbereitschaft oder EKG-Veränderungen unter Belastung können indirekt Hinweise geben.
- Grenzen der Diagnostik
- Magnesium ist größtenteils intrazellulär & Knochen gespeichert – Blutwerte erfassen nur einen Bruchteil.
- Ein normaler Laborwert schließt einen Mangel nicht sicher aus.
- Symptome können sehr unspezifisch sein und leicht mit anderen Ursachen verwechselt werden (z.B. Eisenmangel, Schlafdefizit, Stress).
Aus den Standardwerten des Blutbildes lässt sich ein Magnesiummangel nicht ableiten. Weder Erythrozytenzahl, Hämoglobin, Hämatokrit, Leukozyten oder Thrombozyten noch das Differenzialblutbild geben darüber Auskunft.
Indirekt können Elektrolytverschiebungen (z.B. Kalium-/Calcium-Mangel), die mit dem Magnesiumstoffwechsel verknüpft sind, auf einen Mangel hindeuten – diese fallen jedoch im Elektrolytprofil und nicht im Blutbild auf.
Fazit: Ein Magnesiummangel lässt sich nicht eindeutig durch Laborwerte im Serum/Vollblut feststellen – er kann „verdeckt“ bleiben, da das meiste Magnesium in Knochen/Gewebe gespeichert ist.
Schlafstörungen & Tagesmüdigkeit
- Magnesium-Mangel in der Nacht
- Anzeichen
- Ein-/Durchschlafprobleme
- Nächtliche Wadenkrämpfe
- Unruhe, Nervosität
- Erhöhte Stressanfälligkeit
- Magnesium fördert Entspannung von Muskeln/Nerven und wirkt als Gegenspieler von Kalzium in Muskelzellen. Es reduziert übermäßige Erregung und unterstützt Muskelentspannung.
- Magnesium reguliert Neurotransmitter und beeinflusst Botenstoffe wie GABA (Gamma-Aminobuttersäure), die für Ruhe und Entspannung entscheidend sind.
- Stress-/Cortisolregulation: Magnesium senkt die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol.
- Beteiligung an der Melatonin-Produktion: Magnesium ist an enzymatischen Prozessen beteiligt, die den Schlaf-Wach-Rhythmus über Melatonin steuern.
- Verbesserte Schlafqualität: Untersuchungen zeigen, dass Mg-Supplementierung besonders bei älteren, oder Personen mit Schlafstörungen die Schlafdauer / -tiefe verbessern kann.
- Anzeichen
- Magnesium-Mangel am Tag
- Energieproduktion in den Zellen: Magnesium ist ein entscheidender Cofaktor in der ATP-Synthese („Energiemolekül“ der Zellen). Mg-Mangel kann zu weniger Energie führen → anhaltende Müdigkeit & Erschöpfung.
- Stabilisierung des Nervensystems: Ein unausgeglichener Mg-Haushalt kann zu Reizbarkeit, Konzentrationsproblemen und schneller Ermüdung führen.
- Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus: Schlafstörungen bei Mg-Mangel äußern sich häufig in Form von Tagesmüdigkeit.
- Stress: Chronischer Stress erhöht den Mg-Verbrauch.
Migräne
Magnesium „beruhigt“ überreizte Migräne-Gehirn
- Dämpft überaktive Nervenzellen
Magnesium sitzt als „Pfropfen“ im NMDA-Kanal (Eingang für Kalzium an Nervenzellen). Ist genug Magnesium da, kommt weniger Kalzium in die Zelle → die Zelle feuert weniger. - Erhöht die Schwelle für die Aura-„Welle“
Die kortikale Spreading Depression (ausbreitende Erregungs-/Hemmungswelle) gilt als Auslöser der Aura. Magnesium macht diese Welle unwahrscheinlicher / kleiner. - Bremst Schmerzbotenstoffe
Magnesium kann die Freisetzung von CGRP/anderen Botenstoffen im Trigeminus-Schmerzsystem dämpfen. Weniger CGRP → weniger Entzündung / weniger Schmerzsignal. - Entspannt / „normalisiert“ Blutgefäße
Magnesium entspannt Gefäßmuskeln und stabilisiert die NO-Balance. Das kann Gefäß-Überreaktionen mindern, die an Übelkeit, Licht-/Lärmempfindlichkeit und Schmerz beteiligt sind. - Unterstützt die Energieversorgung der Zellen
ATP – die „Energie-Währung“ – funktioniert eigentlich als Magnesium-ATP. Bei Migräne gibt es Hinweise auf Energiekrisen im Gehirn. Mehr Magnesium → stabilere Mitochondrien → weniger Stress für Nervenzellen. - Warum es nicht allen hilft
Nicht jede Migräne wird von Mg-Mangel oder NMDA/CGRP-Überaktivität getrieben. Auslöser & Biologie sind individuell. - Warum i.v. in der Attacke
Als Infusion kommt Magnesium schnell/in höherer Konzentration ins Blut/Gehirn. Das kann die oben genannten Mechanismen akut anstoßen (v.a. bei Aura).
Unterstützung bei Migräne
- Vorbeugung (täglich einnehmen)
- Wirkung: Magnesium kann die Anzahl/Stärke der Attacken senken. Es ist kein Wundermittel, aber einen Versuch wert.
- Sinnvoll: Besonders bei Migräne mit Aura, menstrueller Migräne und bei Mg-Defizit über die Nahrung.
- Dosierung: Meist 400–600 mg Magnesium pro Tag. Optimal: verteilt auf 2 Einnahmen zu den Mahlzeiten.
- Form: Mg-Citrat/-glycinat wird oft besser vertragen als Oxid.
- Reaktion: Dem Versuch 8–12 Wochen Zeit lassen und Migränetagebuch führen. Danach entscheiden: weiter, anpassen oder weglassen.
- Nebenwirkung: Weicher Stuhl/Durchfall möglich → Dosis verringern, aufteilen oder Mg-Form wechseln.
- Attacke (Akut)
- Tabletten: Orales Magnesium hilft meist nicht schnell genug für den Akutschmerz, aber einen Versuch wert.
- Klinik/Notaufnahme: Mg-Sulfat i.v. (1–2 g) kann manchen helfen, besonders bei Aura. Es ist eine Option wenn andere Mittel (z.B. Triptane/NSAIDs) nicht gehen.
- Sicherheit & Tipps
- Niere: Bei eingeschränkter Nierenfunktion nur nach Rücksprache mit Arzt – sonst kann sich Magnesium anreichern.
- Andere Medikamente: Magnesium kann deren Aufnahme stören.
- Allgemein: Starte eher niedrig und steigere langsam. Achte darauf, ob die Packung die Elementarmenge oder Salzmenge angibt – das ist nicht dasselbe.
- Blutwert: Ein normaler Mg-Blutwert schließt einen funktionellen Mangel nicht sicher aus.
- Menstruelle Migräne: Man kann Magnesium auch zyklisch nehmen.
- Mini-Fahrplan zum Ausprobieren
- Form: Mg-Citrat/-glycinat.
- Start: 200–300 mg abends für 1 Woche.
- Ziel: 400–600 mg/Tag (geteilt morgens/abends).
- Beobachten: 8–12 Wochen Kopfschmerztagebuch führen.
- Bewertung: Migränetage weniger/spürbar schwächer → weitermachen, absetzen oder anderes versuchen.
Mehr Infos in meinem nächsten Blog-Artikel: Migräne & andere Kopfschmerzen.
Bluthochdruck
Magnesium spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Bluthochdruck und Gefäßgesundheit.
- Wirkung
- Gefäßerweiterung (Vasodilatation): Magnesium entspannt die glatte Gefäßmuskulatur, was zu einer Weitstellung der Arterien und Senkung des Blutdrucks führt.
- Kalzium-Antagonist: Es wirkt ähnlich wie Kalziumkanalblocker, indem es den Einstrom von Kalzium in die Zellen reduziert. So wird die Gefäßkontraktion vermindert.
- Elektrolyt-Balance: Magnesium beeinflusst das Gleichgewicht von Natrium und Kalium, was für die Blutdruckkontrolle entscheidend ist.
- Stressreduktion: Ein ausreichender Mg-Spiegel kann das sympathische Nervensystem beruhigen und so Blutdruckspitzen abmildern.
- Besonders profitieren Personen mit Mg-Mangel, Übergewicht oder bereits bestehendem Bluthochdruck.
- Die blutdrucksenkende Wirkung ist eher moderat, aber als Teil eines Gesamtkonzeptes (Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, evtl. Medikamente) sinnvoll.
- Hinweis!
- Mg-Mangel kann Bluthochdruck verstärken und das Risiko für Herzrhythmusstörungen erhöhen.
- Überdosierung (>1000 mg/Tag) kann zu Durchfall, Übelkeit oder Herzrhythmusstörungen führen – bei Niereninsuffizienz sind schon deutlich geringere Mengen riskant.
- Magnesium ist kein Ersatz für eine antihypertensive Therapie, sondern eine unterstützende Maßnahme.
Weitere mögliche Einsatzbereiche von Magnesium
- Akute Indikationen: Präeklampsie / Eklampsie, Kardiovaskuläre Rhythmusstörungen, Akutes schweres Asthma
- Verdauung & Stoffwechsel: Verdauungsbeschwerden (Dyspepsie, Obstipation), Stoffwechsel- & Metabolisches Syndrom, Bessere Glukose- / Insulinregulation, Prävention von Osteoporose
- Frauenheilkunde: PMS-Symptome (Stimmungsschwankungen, Krämpfe), Linderung von Regelschmerzen
- Herz-Kreislauf & Stoffwechsel: Herzgesundheit, Blutdruckregulation, Blutzuckerregulation
- Nerven & Psyche: Depression & Angst, Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit, Unterstützung kognitiver Funktionen
- Muskulatur & Sport: Wadenkrämpfe, Muskelkater, Erholung nach Sport
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker 😉
Mythencheck
- „Nur organische Verbindungen sind wirksam“ Oft heißt es, Magnesium in organischen Verbindungen (z.B. Citrat, Bisglycinat, Malat) sei den anorganischen (z.B. Oxid, Carbonat, Sulfat) grundsätzlich überlegen. Das stimmt so nicht:
- Organische Formen haben tendenziell eine bessere Löslichkeit und werden meist leichter resorbiert.
- Anorganische Formen wie Mg-Oxid enthalten jedoch einen sehr hohen Anteil an elementarem Magnesium – sie wirken, brauchen aber länger um sich im Darm aufzulösen.
- Mg-Oxid als „Depotform“ Häufig wird Mg-Oxid als „Depotform“ beworben, die den Körper über längere Zeit gleichmäßig mit Magnesium versorgt. Das stimmt nur teilweise:
- Im Blut: Nach der Aufnahme liegt Magnesium immer als Mg²⁺-Ion vor. Die Halbwertszeit beträgt rund 24 h – unabhängig ob aus Citrat, Oxid oder anderen Verbindung.
- Es gibt keine speziellen Depots im Körper.
- Im Darm:
- Mg-Oxid ist schlecht wasserlöslich. Dadurch wird es nur langsam, in geringen Mengen (ca. 5–15 %) aufgenommen. Die Resorption zieht sich über mehrere Stunden hin – dadurch entsteht der Eindruck einer Depotwirkung.
- Mg-Citrat ist gut wasserlöslich. Dadurch wird es schnell und vergleichsweise effizient (ca. 30–40 %) aufgenommen. Der Blutspiegel steigt schneller an, fällt aber auch schneller wieder ab, wenn keine weitere Zufuhr erfolgt.
- „Je teurer, desto besser“ Hochpreisige Produkte werben oft mit „besonders innovativen“ Mg-Formen (z.B. liposomal, „ultragepuffert“). Dafür gibt es keine klaren Hinweise gegenüber klassischen Verbindungen.
- „Wirkt gezielt im Gehirn oder Herz“ Manche behaupten, bestimmte Mg-Formen können gezielt einzelne Organe versorgen. Das ist wissenschaftlich nicht belegt – Magnesium wird über das Blut verteilt, unabhängig von der Verbindung.
- „Nur NEM decken den Bedarf“ Bei gesunder Ernährung (Nüsse, Vollkorn, Gemüse, Hülsenfrüchte) kann der Bedarf vielleicht gedeckt werden, wenn kein erhöhter Mg-Verbrauch & -verlust oder Mangel vorliegt.
*1 Enzymbeteiligung: Ein maßgebliches Review (Physiological Reviews) fasst zusammen, dass aktuelle Enzymdatenbanken >600 Enzyme mit Mg²⁺ als Cofaktor listen und bei weiteren ~200 eine Aktivator-Rolle diskutiert wird. Das geht deutlich über die oft zitierten „>300“ hinaus (PDF).
DOKU-Tipps: ▶️ Videos / ℹ️ Infos – Die Reihenfolge ist keine Wertung.
▶️ Prof.Dr. Elmar Wienecke: Mikronährstoffmangel mit dramatischen Folgen
▶️ Mag.Dr.rer.nat. Markus Stark: Spurenelemente & Mineralien – So wichtig sind sie wirklich
▶️ Prof.Dr.med. Jörg Spitz & Dr.med. Petra Wiechel: Welche Nahrungsergänzungsmittel sind wirklich wichtig?
▶️ Dr.med. Petra Wiechel: Magnesiummangel – Ursache vieler Leiden und chronischen Krankheiten
▶️ Dr.med. Ulrich Selz: Das passiert, wenn Du nachts MAGNESIUM nimmst
▶️ Dr.med. Ulrich Selz: Magnesiummangel – kaufe nicht das FALSCHE Magnesium
Auch Fachleute irren! Im Video wird Falsches behauptet, z.B. „Mg-Oxid ist an eine Fettsäure gebunden“ DAS IST FALSCH
▶️ Dr.med. Heinz Lüscher: Gesund essen reicht nicht! Warum Vitamin- / Mineralstoffmängel unsere Gesundheit gefährden
▶️ Prof. Hans Rausch: Krämpfe – und der Irrglaube von Magnesium
▶️ Dr.med. Volker Schmiedel M.A.: Magnesium – Das Antistress Mineral
▶️ Dr.rer.nat. Bruno Kugel: Magnesiummangel: Die unsichtbare Epidemie, die Millionen betrifft
Kritisch bleiben: Auch wenn ein Arzt oder Wissenschaftler etwas empfiehlt oder verkauft, beweist das nicht seine Wirksamkeit. Gründliche Recherche / Rücksprache kann helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden.
FAZIT: Nahrungsmittel verlieren einen erheblichen Teil ihres Nährstoffgehalts durch
- Anbau & Umwelt: ausgelaugte Böden, Monokulturen, Pestizide, Züchtungen
- Ernte & Lagerung: zu frühe/späte Ernte, lange Transport-/Lagerzeiten, Licht, Sauerstoff, Temperatur
- Industrielle Verarbeitung: Schälen, Raffinieren, Erhitzen, Pasteurisieren, Konservieren, Bestrahlen
- Häusliche Zubereitung: Kochen, Braten, Warmhalten, Verluste beim Abgießen
Gleichzeitig steigt unser Bedarf durch erhöhten Verbrauch & Verlust im Körper.
Geringere Zufuhr + höherer Bedarf begünstigen Mangelzustände – besonders bei Magnesium.
Magnesium gehört zu den am meisten unterschätzten Mineralstoffen. Trotz ärztlicher Routinekontrollen bleibt ein Mangel oft unentdeckt – und kann im Hintergrund zahlreiche Beschwerden verursachen.
Bei einer Supplementierung kommt es nicht nur auf die Menge an, sondern auch auf die richtige Form und Bioverfügbarkeit.
Magnesium ist weit mehr als ein „einfacher Nahrungsergänzer“.
Magnesium ist ein zentraler Baustein für Leistungsfähigkeit, Gesundheit & Wohlbefinden.
Hinweis: Dieser Artikel wurde von einem Ernährungsberater verfasst und dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Er ersetzt keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellt keine Therapie dar.
Medizinischer Disclaimer
Ärztlicher Hinweis: Vor eigenmächtigen Anwendungen oder Einnahmen sollte ein Arzt konsultiert werden, um Risiken sowie Neben- oder Wechselwirkungen – z. B. mit Medikamenten – auszuschließen.