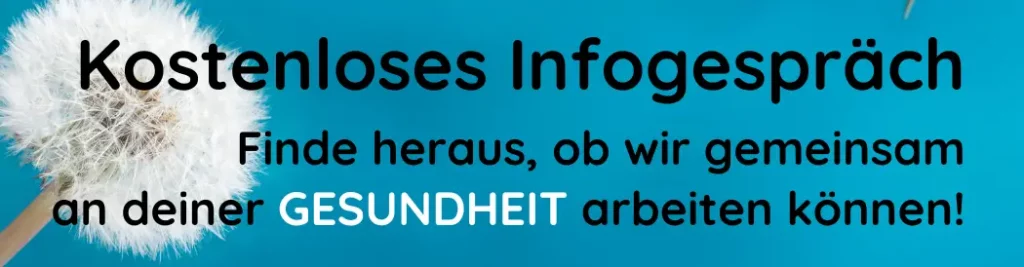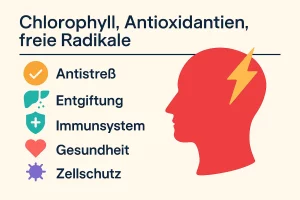# Fakten, Mythen und Irrtümer zu Omega-6/-3-Fettsäuren, EPA & DHA
# Was steckt wo drin, was kann der Körper verwerten?
# Warum sind manche als gesund geltende Pflanzenöle problematisch?
# Können Omega-Fettsäuren heilend oder schädlich wirken?
# Liefern pflanzliche Öle oder Fisch die richtigen Fettsäuren?
Omega-6/-3-Fettsäuren sind essenzielle, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann und über die Nahrung aufnehmen muss.
Ein ausgewogenes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 ist entscheidend für die Gesundheit, da ein Überschuss an Omega-6 (z.B. durch Sonnenblumenöl) entzündungsfördernde Prozesse begünstigen kann.
Omega-6
- Hauptvertreter: Linolsäure (LA)
- Kann im Körper in Arachidonsäure (AA) umgewandelt werden
- Hauptquellen: Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl. Auch tierische Produkte (z.B. Fleisch, Eier) liefern Arachidonsäure direkt
- Funktionen:
- Strukturelement von Zellmembranen
- Beteiligung an Wundheilung, Immunfunktionen und Entzündungsprozessen
- Arachidonsäure dient als Ausgangsstoff für Eikosanoide – diese wirken u.a. entzündungsfördernd, sind aber essenziell für Immunabwehrreaktionen !!
Omega-3
- Hauptvertreter: Alpha-Linolensäure (ALA)
- Kann im Körper zu Eicosapentaensäure (EPA) und weiter zu Docosahexaensäure (DHA) umgewandelt werden – jedoch sehr ineffizient & begrenzt (ca. 0,5–10 %)
- Hauptquellen: ALA: Leinöl, Rapsöl, Walnüsse, Chiasamen. EPA/DHA: Fettfische (z. B. Lachs, Makrele, Hering), Algenöl (vegane Quelle)
- Funktionen:
- ALA (pflanzlich)
- Vorstufe von EPA/DHA
- Beitrag zur Zellmembranstabilität und Regulation von Genfunktionen
- EPA (maritim/algenbasiert)
- Hemmt Bildung entzündungsfördernder Eikosanoide aus Arachidonsäure
- Entzündungshemmend, immunmodulierend
- Kardioprotektiv: Reduktion von Blutgerinnung, Blutdrucksenkung, Gefäßerweiterung
- Stimmungsstabilisierend: Mögliche unterstützende Wirkung bei affektiven Störungen (z.B. Depression)
- DHA (maritim/algenbasiert)
- Wesentlicher Bestandteil von Gehirn, Netzhaut und Nervenzellen
- Wichtig für Gehirnentwicklung bei Föten & Säuglingen
- Unterstützt kognitive Funktionen und Sehfunktion
- ALA (pflanzlich)
Unzureichende körpereigene Umwandlung
Viele Menschen – insbesondere Vegetarier / Veganer – nehmen ausschließlich Alpha-Linolensäure (ALA) über pflanzliche Quellen auf und glauben, dass ihr Körper daraus ausreichend EPA/DHA bilden kann. Das Problem: Die körpereigene Umwandlung ALA → EPA → DHA ist sehr ineffizient – selbst unter optimalen Bedingungen.
- ALA → EPA: 5 – 10 %
- EPA → DHA: 0,5 – 5 %
Die Umwandlungsrate kann durch verschiedene Faktoren zusätzlich gesenkt werden
- Ungünstiges Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren
- Genetische oder Hormonelle Faktoren
- Nährstoffstatus (z.B. Zink, Vitamin B6, Eisen sind Cofaktoren)
Empfohlene Zufuhr
Wer EPA & DHA nicht direkt konsumiert (z.B. durch fettreichen Seefisch, Algenöl), hat oft unzureichende Blutspiegel dieser essenziellen Fettsäuren. Deshalb geben Fachgesellschaften (DGE, EFSA) konkrete Empfehlungen.
- Gem. DGE im Verhältnis 5:1 (Omega-6 zu Omega-3)
- Omega-6 mind. 2,5 % der täglichen Energiezufuhr
- Omega-3 mind. 0,5 % der täglichen Energiezufuhr
- Entspricht etwa 250 mg EPA + DHA pro Tag, bzw. 1–2 Portionen fettreicher Seefisch pro Woche.
Speicher & Dauer im Körper
Die Speicherung und Verweildauer im Körper unterscheidet sich je nach Fettsäuretyp, Speicherort und physiologischen Bedingungen.
- ALA (Alpha-Linolensäure – Omega-3, pflanzlich)
- Speicherort: Fettgewebe, Leber, geringer Anteil in Zellmembranen
- Funktion: Vorstufe für die körpereigene Synthese von EPA/DHA, Energiequelle
- Speicherdauer: Wochen → wenige Monate – abhängig von Stoffwechsel und Energiebedarf
- EPA (Omega-3)
- Speicherort: Zellmembranen in Leber, Muskel, Immunzellen, Plasma-Lipoproteine
- Funktion: Vorstufe von entzündungsmodulierenden Eicosanoiden und Resolvinen, auch Einfluss auf Gefäßfunktion und Immunreaktion
- Speicherdauer: Tage → wenige Wochen – schnellerer Umsatz als DHA, abhängig vom Entzündungsstatus
- DHA (Omega-3)
- Speicherort: Zellmembranen von Gehirn, Retina (Netzhaut), Spermien, Nervenzellen
- Funktion: Struktureller Bestandteil neuronaler Membranen; wichtig für Signalübertragung, Sehvermögen und neuronale Plastizität
- Speicherdauer: Monate → über ein Jahr – besonders im Gehirn sehr langsamer Austausch (~0,5–1 % pro Tag)
- LA (Linolsäure – Omega-6)
- Speicherort: Fettgewebe, Leber, Zellmembranen von Haut- und Immunzellen
- Funktion: Essenzielle Fettsäure, Baustein von Zellmembranen, Vorstufe für Arachidonsäure (AA)
- Speicherdauer: Wochen → Monate – v. a. im Fettgewebe stabil gespeichert
- AA (Arachidonsäure – Omega-6)
- Speicherort: Phospholipide von Zellmembranen (v.a. in Immunzellen, Leber, Gehirn, Muskel)
- Funktion: Vorläufer für proinflammatorische Eicosanoide, essenziell für Immunantworten
- Speicherdauer: Monate – wird bei Bedarf aus Membranen freigesetzt (z. B. bei Entzündung)
Hinweise
- EPA ist dynamisch reguliert, DHA eher strukturell fixiert
- ALA/LA dienen vorrangig als Vorstufen und Energiespeicher
- Die Verfügbarkeit hängt stark von Ernährung, Stoffwechsel und körperlichem Zustand ab
- Fettgewebe dient als passiver Langzeitspeicher; dort eingelagerte Fettsäuren werden nur langsam mobilisiert
- Zellmembranen (v.a. Gehirn) sind aktive, funktionelle Speicher – ein Mangel wirkt sich hier direkt auf Zellfunktion und Signalweiterleitung aus
- Die Verfügbarkeit im Blutplasma ist sehr dynamisch, und kann sich binnen Tagen verändern
Hitze → thermische Zerstörung
Die positiven Eigenschaften von Omega-6/-3-Fettsäuren – insbesondere ihre gesundheitsfördernde Wirkung durch ungesättigte Doppelbindungen – sind wärmeempfindlich. Schon beim normalen Erhitzen in der Küche kann es zu Oxidation, Isomerisierung und Abbau dieser Fettsäuren kommen.
|
Fettsäuretyp |
Temperaturbereich |
Anwendungstemperatur |
|
Omega-3 |
ab 90°C empfindlich |
max. 100–120°C |
|
Omega-6 |
ab 130°C oxidativ instabil |
max. 160–170°C |
Omega-6
- Weniger empfindlich als Omega-3, aber deutlich instabiler als einfach ungesättigte Fettsäuren
- Ab 130°C treten signifikante Oxidationsreaktionen auf
- Raffinierte Pflanzenöle mit hohem Omega-6-Gehalt (z.B. Sonnenblumenöl) sind hitzestabiler, aber enthalten meist keine nennenswerten Mengen an bioaktiven Omega-6-Verbindungen
Omega-3 (besonders EPA & DHA)
- Sehr oxidationsempfindlich aufgrund mehrfacher Doppelbindungen
- Ab 120°C beginnen die Doppelbindungen zu zerfallen → Bildung von Oxidationsprodukten
- EPA & DHA aus Fischöl/Algenöl sollte nicht erhitzt werden – selbst bei mildem Erhitzen (z.B. Dünsten) sinkt der Gehalt deutlich
- Besonders instabil beim Braten, Backen, Frittieren
Küchentemperaturen im Vergleich
|
Kochmethode |
Typische Temperatur |
|
Dünsten |
80–100 °C |
|
Kochen |
100 °C |
|
Leichtes Braten |
120–150 °C |
|
Scharfes Braten |
180–200 °C |
|
Frittieren |
170–190 °C |
|
Backen |
160–220 °C |
Die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Omega-3 (v.a. EPA & DHA) werden bei typischen Brat-/Frittier-Temperaturen weitgehend zerstört. Besser geeignet sind:
- Kaltgepresste Öle (Lein-, Raps-, Walnussöl) nur kalt verwenden
- Fettreicher Fisch (z. B. Lachs, Makrele) schonend Garen (Dämpfen)
- EPA & DHA aus Algenöl oder kalten Speisen
EPA & DHA in Fisch
- EPA/DHA sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren und daher wärmeempfindlich, aber nicht extrem hitzezerstörbar wie z.B. Vitamine
- Beim moderaten Garen (Dämpfen, Kochen, Backen) oder industriellen Erhitzen werden Teile der Omega-3-Fettsäuren erhalten, vor allem wenn das Fett im Produkt verbleibt
- Hauptverluste entstehen durch:
- Oxidation (z.B. bei Luftkontakt, Licht, langem Erhitzen)
- Austritt von Fett in Garflüssigkeit oder Öl
- Zubereitung
- Schonende Garmethoden (Dämpfen, Niedrigtemperaturgaren) erhalten den Großteil der Omega-3-Fettsäuren
- Scharfes Anbraten bei hoher Hitze (>180 °C) kann einen Teil zerstören, aber bei kurzem Kontakt bleibt noch viel EPA/DHA erhalten
- Industrielle Erhitzung (z.B. Dosenfisch) durch Sterilisation (110–130 °C, 30–90 Minuten) oder Pasteurisation (mildere Temperaturen)
- Auswirkung auf EPA & DHA
- Trotz der Erhitzung bleiben oft große Mengen an EPA & DHA erhalten
- Besonders in fettreichen Fischsorten wie Makrele, Sardine, Hering
- Thunfisch enthält ebenfalls EPA & DHA, aber oft weniger Fett (je nach Teilstück)
- In konservierten Sardinen oder Thunfischdosen bleiben oft 60–90 % der ursprünglichen Omega-3-Fettsäuren erhalten
Eigenschaften & Hitze
Wenn wir über die positiven Eigenschaften von Omega-6/-3-Fettsäuren sprechen, meinen wir typischerweise ihre physiologische Wirkung im gesunden, intakten Zustand – also vor einer Schädigung durch Hitze, Oxidation oder Verarbeitung. Sobald diese Fettsäuren jedoch degradiert werden (z.B. durch Hitze, Sauerstoff, Licht), können negative Eigenschaften auftreten – das betrifft nicht die Fettsäuren selbst, sondern ihre Abbauprodukte.
Ungesättigte Fettsäuren (insbesondere EPA, DHA, Linolsäure) sind reaktiv und instabil bei Hitze. Wird die Temperatur zu hoch oder das Erhitzen zu lang können problematische Verbindungen entstehen.
Problematische Verbindungen
|
Stoffklasse |
Entstehung |
Mögliche Wirkung |
|
Lipidperoxide |
Frühform der Oxidation |
Zellschädigung, Entzündung |
|
Aldehyde |
Spaltprodukte oxidierter Fette |
zelltoxisch, mutagen, entzündungsfördernd |
|
Transfettsäuren |
Isomerisierung bei hoher Hitze |
fördern LDL-Cholesterin, Entzündung, Atherosklerose |
|
Ketone, Epoxide |
Folgeprodukte tiefer Oxidation |
zelltoxisch, möglicherweise krebserregend |
- Im ursprünglichen Zustand sind Omega-6/-3-Fettsäuren gesundheitsfördernd
- Bei starker Erhitzung können sie jedoch degradieren – die entstehenden Oxidations- / Abbauprodukte sind potenziell schädlich und stehen im Verdacht, z.B. zu:
- zellulärem Stress
- Gefäßschädigung
- chronischer Entzündung
- vermehrter Tumorbildung
- Deshalb sollte man:
- empfindliche Öle nicht erhitzen
- Fisch / fetthaltige Speisen schonend garen
- altes Frittieröl meiden
Negative Eigenschaften & Hitze
Arachidonsäure (AA), eine Omega-6-Fettsäure, hat zwei unterschiedliche Ebenen der Wirkung, die oft vermischt werden:
- Biologische Wirkung im Körper: AA ist in Zellmembranen eingebaut und wird bei Bedarf freigesetzt → daraus entstehen Eikosanoide → Diese können entzündungsfördernd wirken, besonders bei Omega-6-Überschuss ohne Omega-3-Ausgleich (Empfehlung 5:1).
- Stabilität beim Erhitzen: In Lebensmitteln liegt AA als Bestandteil von Membranlipiden oder Triglyzeriden vor (z.B. in Fleisch, Eigelb, Innereien). Bei Hitze kann sie oxidieren → chemisch verändert / abgebaut werden, bevor sie im Körper wirksam werden könnte.
- Wärmeempfindlichkeit: Ab ~120 °C beginnt oxidativer Abbau
- Negative Wirkung: Durch Hitze degradierte AA kann nicht mehr als Vorläufer entzündlicher Eikosanoide dienen
Arachidonsäure (AA) erhitzen
- Oxidationsanfälligkeit: Sehr hoch, ähnlich wie EPA → Bildung von Lipidperoxiden
- Wärmeempfindlichkeit: >120 °C beschleunigter oxidativer Abbau → Bildung toxischer Verbindungen
- Isomerisierung: >160 °C Bildung von Transfettsäuren
- Verlust der Funktion: Oxidierte AA kann nicht mehr zu entzündungsfördernden Eikosanoiden umgewandelt werden
Auswirkungen für Ernährung & Gesundheit
- Die entzündungsfördernde Wirkung von AA ist nur relevant, wenn sie in aktiver, intakter Form aufgenommen oder im Körper gebildet wird
- Bei starker Erhitzung (z.B. Braten, Grillen, Frittieren) wird sie teilweise zerstört – gleichzeitig entstehen aber oxidierte Lipid-Abbauprodukte, die selbst entzündungsfördernd und zelltoxisch sein können
- Hitze zerstört AA (→ weniger Eikosanoide), erzeugt aber andere schädliche Substanzen
Sonnenblumenöl
Sonnenblumenöl weist ein extrem unausgewogenes Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren auf – typischerweise über 200:1, in manchen Varianten sogar über 700:1.
Fettsäurezusammensetzung (klassisches Sonnenblumenöl):
- Omega-6-Fettsäuren (v.a. Linolsäure): 65–70 %
- Omega-3-Fettsäuren (v.a. Alpha-Linolensäure): < 0,1 %
Ein dauerhaft hohes Omega-6/3-Verhältnis in der Ernährung kann entzündliche Prozesse im Körper begünstigen, insbesondere wenn gleichzeitig zu wenig Omega-3 (z. B. aus Fisch, Algenöl, Rapsöl) konsumiert wird.
Empfehlungen privat:
- Zu Hause: Sonnenblumenöl durch gesündere Alternativen ersetzen:
- Kalte Küche: Rapsöl, Leinöl oder Olivenöl
- Warme Küche: Olivenöl
- Beim Einkauf: Produkte reduzieren, die Sonnenblumenöl enthalten oder damit behandelt wurden (z.B. vorfrittierte Lebensmittel).
- Außer Haus: Restaurants, Kantinen oder Imbisse bevorzugen, die Gerichte ohne Sonnenblumenöl zubereiten – Im Zweifel nachfragen!
Empfehlungen für das Stammlokal: Für Fritteusen in Imbissen oder Kantinen gibt es mehrere Alternativen zu Sonnenblumenöl, die gesundheitlich vorteilhafter oder zumindest stabiler beim Erhitzen sind. Wichtig ist dabei vor allem der Rauchpunkt (Wärmebeständigkeit) und die Fettsäurenzusammensetzung (weniger Omega-6, mehr einfach ungesättigte Fettsäuren).
- High-Oleic Sonnenblumenöl
- Vorteil: Hitzestabil, weniger Omega-6, neutraler Geschmack.
- Gesünder als normales Sonnenblumenöl, da es hauptsächlich einfach ungesättigte Fettsäuren enthält.
- Kosten: Etwas teurer als herkömmliches Sonnenblumenöl, aber weit verbreitet in der Gastronomie.
- High-Oleic Rapsöl
- Vorteil: Hoher Rauchpunkt, reich an einfach ungesättigten Fettsäuren.
- Neutraler Geschmack, sehr gute Fritteuseigenschaften.
- Kosten: Leicht teurer als Standard-Rapsöl, aber günstiger als Olivenöl.
- Palmöl (nicht empfohlen aus ökologischen Gründen)
- Technisch stabil, wird häufig in der Industrie verwendet.
- Nachteil: Umweltschädlich (Regenwaldzerstörung), ethisch und gesundheitlich umstritten.
- Kosten: Günstig – daher weit verbreitet, aber aus Nachhaltigkeitsgründen problematisch.
- Erdnussöl
- Vorteil: Sehr hitzestabil, nussiger Geschmack, geeignet zum Frittieren.
- Nachteil: Kann Allergien auslösen, etwas teurer.
- Kosten: Mittel bis hoch, je nach Qualität.
- Kokosöl (raffiniert)
- Vorteil: Sehr stabil beim Erhitzen.
- Nachteil: Enthält viele gesättigte Fettsäuren – gesundheitlich umstritten.
- Kosten: Deutlich teurer als Sonnenblumenöl.
Sonnenblumenöl in der Nahrungsmittelindustrie
Sonnenblumenöl ist weit verbreitet in verarbeiteten Lebensmitteln und der Gastronomie, weil es geschmacksneutral und hoch erhitzbar ist. Dadurch wird es in vielen Produkten verwendet, teils auch versteckt:
Typische Einsatzbereiche
- Frittier- / Bratprodukte (Tiefkühlprodukte)
- Pommes frites, Kroketten, Rösti
- Frühlingsrollen, Chicken Nuggets, Fischstäbchen
- TK-Gemüse mit Fettzugabe (z. B. Rahmspinat, Wokmischungen)
- TK-Pfannenfertiggerichte mit gebratenen Zutaten
- Backwaren / Convenience / Snacks
- Fertiggerichte, Dressings und Saucen
- Blätterteigprodukte, Mini-Pizzen, Croissants
- Donuts, Berliner, Krapfen
- Chips, Cracker, Erdnussflips, Salzgebäck
- Fisch- / Fleischprodukte, vegane / vegetarische Alternativen
- Paniertes Fleisch, Fisch, Backfisch, Bratlinge
- Vorgebratene Hackfleischprodukte
- Vegane Nuggets, Burger, Bratlinge
- Falafel, panierte Produkte
- Außer Haus
- Frittierte Speisen in Kantinen, Imbissen, Restaurants
- Großküchen in Krankenhäusern, Mensen, Catering
Gründe für Sonnenblumenöl: Sonnenblumenöl zählt zu den meistverwendeten pflanzlichen Ölen. Das hat mehrere ökonomische, technologische und geschmackliche Gründe:
- Ökonomische Faktoren – Anbau & Verfügbarkeit
- Hoher Ertrag
- Günstig in der Produktion
- Breite Verfügbarkeit weltweit
- Billiger als z.B. Raps- / Olivenöl
- Technologische Vorteile
- Neutraler Geschmack
- Lange Haltbarkeit: Relativ stabil gegenüber Oxidation
- Hitzestabil (bei raffiniertem Öl): Ideal zum Braten, Frittieren und Backen
- Verarbeitungseigenschaften
- Verarbeitbarkeit: Durch die Raffination ist das Öl klar, flüssig und gut
- Konsistenzkontrolle: Mit Sonnenblumenöl lässt sich die gewünschte Textur oder Stabilität eines Produkts zuverlässig steuern
- Verbraucherakzeptanz
- Image: Sonnenblumenöl gilt als leicht, natürlich und gesund – vor allem im Vergleich zu tierischen Fetten
- Vertrauen in die Herkunft: Im Gegensatz zu tropischen Fetten (z.B. Palmöl) wird Sonnenblumenöl oft mit regionalem Anbau assoziiert
Sonnenblumenöl erhitzen: Sonnenblumenöl enthält hohe Mengen an Omega-6-Fettsäuren, insbesondere Linolsäure (LA), die im Körper zu Arachidonsäure (AA) umgewandelt werden kann. Diese Verbindung hat direkten Bezug zur Entstehung von entzündungsfördernden Eikosanoiden.
- Fettsäurezusammensetzung (klassisches Sonnenblumenöl)
- Linolsäure (LA, Omega-6) 60–75 %
- Ölsäure (Omega-9) 15–30 % (mehr in High-Oleic-Sorten)
- Arachidonsäure (AA) nicht direkt enthalten – wird im Körper aus LA gebildet
- Auswirkung beim Frittieren in Sonnenblumenöl
- Linolsäure ist relativ oxidationsanfällig
- Ab ca. 160 °C beginnt sie zu oxidieren, bei typischen Frittier-Temperaturen (170–190 °C) läuft die Zersetzung rasch
- Dabei entstehende Produkte:
- Lipidperoxide → instabil, zerfallen weiter
- Aldehyde
- Ketone, Alkohole, Transfette bei mehrfacher Wiederverwendung
- Auch wenn Sonnenblumenöl raffiniert und hitzestabilisiert ist, oxidieren die Omega-6-Fettsäuren beim Frittieren mit der Zeit deutlich – insbesondere bei mehrfachem Erhitzen.
- Auswirkung auf Arachidonsäurebildung & Gesundheit
- Beim Frittieren werden Linolsäure und ihre Vorstufen so stark oxidiert, dass keine nennenswerte Umwandlung zu Arachidonsäure mehr möglich ist.
- Stattdessen entstehen oxidierte Fettsäurereste, die selbst entzündungsfördernd und zellschädigend sein können.
- Beispiel: Chips, Pommes, Frittierprodukte
- In Sonnenblumenöl vor- / frittierte Produkte enthalten häufig:
- wenig funktionelle Linolsäure (wegen Zersetzung)
- keine aktive Arachidonsäure
- dafür: oxidierte Lipidnebenprodukte
- Besonders kritisch: industrielles Frittieren über viele Stunden/Tage, oder mehrfach verwendetes Öl in Imbissen.
- Beim Frittieren mit Sonnenblumenöl werden die gesunden Eigenschaften der Omega-6-Fettsäuren weitgehend zerstört.
- Es entsteht zwar keine entzündungsfördernde Wirkung durch Arachidonsäure.
- Dafür entstehen oxidierte Fettsäure-Abbauprodukte, die selbst entzündungsfördernd, zelltoxisch oder potenziell krebserregend sein können.
- In Sonnenblumenöl vor- / frittierte Produkte enthalten häufig:
DOKU-Tipps: 🎦 Video / 📄 Info – Die Reihenfolge ist keine Wertung.
🎦 Dr. med. Simon Feldhaus – Leinöl reicht nicht aus!
🎦 Dr. med. Friderike Wiechel – Omega 3 für das kleine Superhirn
🎦 Prof. Dr. Jörg Spitz & Prof. Clemens von Schacky – Omega 3 Index & Optimale Dosierung – ALA, EPA & DHA
🎦 Dr. med. Volker Schmiedel – Omega-3-Fettsäure wirkt lebensverlängernd / Die Wirkung von EPA & DHA
Kritisch bleiben: Auch wenn ein Arzt oder Wissenschaftler etwas empfiehlt oder verkauft, beweist das nicht seine Wirksamkeit. Gründliche Recherche / Rücksprache kann helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden.
FAZIT:
- Ein ausgewogenes Verhältnis (5:1) von Omega-6– zu Omega-3-Fettsäuren ist entscheidend für entzündungsregulierende Prozesse im Körper.
- EPA & DHA haben protektive und entzündungshemmende Wirkungen.
- Die körpereigene Umwandlung pflanzlicher ALA (Omega-3) in EPA & DHA ist sehr ineffizient, insbesondere bei hoher Omega-6-Zufuhr.
- Omega-6-Fettsäuren wie Linolsäure und Arachidonsäure sind wärmeempfindlich und werden zwar bei hohen Temperaturen oxidativ zerstört, dabei entstehen jedoch andere gesundheitlich bedenkliche Abbauprodukte wie Aldehyde, Peroxide oder Transfettsäuren.
- Sonnenblumenöl ist aufgrund seines extrem hohen Omega-6-Gehalts und der Oxidationsanfälligkeit bei Hitze kritisch zu bewerten.
- Industrie- und Frittierprodukte mit Sonnenblumenöl enthalten meist keine gesundheitsförderlichen Fettsäuren mehr.
- EPA & DHA sollten idealerweise direkt über fettreichen Fisch oder Algenöl zugeführt werden.
- Eine schonende Zubereitung sind zentrale Bestandteile einer entzündungsmodulierenden Ernährung.
Hinweis: Dieser Artikel wurde von einem Ernährungsberater verfasst und dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Er ersetzt keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellt keine Therapie dar.
Medizinischer Disclaimer
Ärztlicher Hinweis: Vor eigenmächtigen Anwendungen oder Einnahmen sollte ein Arzt konsultiert werden, um Risiken sowie Neben- oder Wechselwirkungen – z. B. mit Medikamenten – auszuschließen.